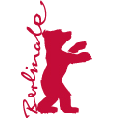 Fragt man den durchschnittlichen US-amerikanischen Blockbusterkinogänger über Deutschland oder speziell Berlin aus, dürfte man wohl alle Klischees zu hören bekommen, die Jaume Collet-Serra uns in seinem Actionthriller „Unknown Identity“ buchstäblich vor den Latz knallt. Deutsche Krankenschwestern heißen in seinem Film nämlich Gretchen Erfurt, Ex-Stasi-Agenten, die vom wohl prägnantesten Hitler-Darsteller, Bruno Ganz, verkörpert werden, haben Kontakt zum Berliner Flughafensicherheitsdienst und sowieso hat Berlin ein großes Illegalen- und Migrantenproblem. Das ist wohl weniger die Weltsicht von Regisseur Collet-Serra, als vielmehr die Sicht auf die Dinge, wie sie Produzent Joel Silver in seinen Filmen immer wieder zum Besten gibt. Liam Neeson dürfte damit wohl am wenigsten ein Problem gehabt haben, dreht er in letzter Zeit doch ohnehin nur noch Actionfilme, in denen er sich zugegeben recht gut schlägt – allen voran für sein Alter. Und auch für Diane Kruger ist es eine Rolle, die sie einmal mehr in ihre Heimat bringt. „Unknown Identity“ ist aber nicht nur wegen Diane Kruger, Bruno Ganz oder Sebastian Koch ein Film mit Lokalkolorit, sondern in erster Linie deshalb, weil der Hauptdarsteller hier ganz klar Berlin heißt. „Berlinale 2011 – Gretchen Erfurts Berlin“ weiterlesen
Fragt man den durchschnittlichen US-amerikanischen Blockbusterkinogänger über Deutschland oder speziell Berlin aus, dürfte man wohl alle Klischees zu hören bekommen, die Jaume Collet-Serra uns in seinem Actionthriller „Unknown Identity“ buchstäblich vor den Latz knallt. Deutsche Krankenschwestern heißen in seinem Film nämlich Gretchen Erfurt, Ex-Stasi-Agenten, die vom wohl prägnantesten Hitler-Darsteller, Bruno Ganz, verkörpert werden, haben Kontakt zum Berliner Flughafensicherheitsdienst und sowieso hat Berlin ein großes Illegalen- und Migrantenproblem. Das ist wohl weniger die Weltsicht von Regisseur Collet-Serra, als vielmehr die Sicht auf die Dinge, wie sie Produzent Joel Silver in seinen Filmen immer wieder zum Besten gibt. Liam Neeson dürfte damit wohl am wenigsten ein Problem gehabt haben, dreht er in letzter Zeit doch ohnehin nur noch Actionfilme, in denen er sich zugegeben recht gut schlägt – allen voran für sein Alter. Und auch für Diane Kruger ist es eine Rolle, die sie einmal mehr in ihre Heimat bringt. „Unknown Identity“ ist aber nicht nur wegen Diane Kruger, Bruno Ganz oder Sebastian Koch ein Film mit Lokalkolorit, sondern in erster Linie deshalb, weil der Hauptdarsteller hier ganz klar Berlin heißt. „Berlinale 2011 – Gretchen Erfurts Berlin“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Far, far from Bollywood
 In „Gandu“ vom indischen Regisseur Q (bürgerlich: Kaushik Mukherjee) tauchen etwa 20 Minuten vor dem Ende bereits die Credits auf, ebenso wie Q selbst – und zwar als Q, der in diesem Film über den Jugendlichen Gandu gerade einen Film über den Jugendlichen Gandu dreht. Neben dem Leser dieser Kritik verwirrt jene Meta-Ebene auch Gandu (Anubrata) einigermaßen. Was aber auch daran liegen mag, dass Gandu, dessen Namen man als ‚Arschloch‘ oder ‚Wichser‘ übersetzen kann, gerade eine ordentliche Portion halluzinogener Drogen zu sich genommen hat. Die hypnotische Visualisierung dieses Rausches greift – wie bei der Nahtoderfahrung in Gaspar Noés „Enter the Void“ – tief in die Trickkiste experimenteller Techniken und ist sinnlich ähnlich beeindruckend wie bei Noé. Wenn der kleinkriminelle Gandu gerade nicht weiblichen Derwischen in seiner von Drogen belebten Fantasie begegnet, schaut er Pornos, masturbiert oder schmeißt in wütenden Rap-Texten mit sämtlichen ihm bekannten Schimpfwörtern um sich. Der restriktiven indischen Zensur wird das ebenso wenig gefallen wie einem einsamen, moralisch empörten Zuschauer aus Indien beim Berlinale-Screening. Für zahlreiche andere Publikumsgruppen – frustrierte Jugendliche, sozial-realistische Cineasten, Freunde des Schwarz-Weiß- und Experimentalfilms – ist „Gandu“ hingegen eine großartige Entdeckung. „Berlinale 2011 – Far, far from Bollywood“ weiterlesen
In „Gandu“ vom indischen Regisseur Q (bürgerlich: Kaushik Mukherjee) tauchen etwa 20 Minuten vor dem Ende bereits die Credits auf, ebenso wie Q selbst – und zwar als Q, der in diesem Film über den Jugendlichen Gandu gerade einen Film über den Jugendlichen Gandu dreht. Neben dem Leser dieser Kritik verwirrt jene Meta-Ebene auch Gandu (Anubrata) einigermaßen. Was aber auch daran liegen mag, dass Gandu, dessen Namen man als ‚Arschloch‘ oder ‚Wichser‘ übersetzen kann, gerade eine ordentliche Portion halluzinogener Drogen zu sich genommen hat. Die hypnotische Visualisierung dieses Rausches greift – wie bei der Nahtoderfahrung in Gaspar Noés „Enter the Void“ – tief in die Trickkiste experimenteller Techniken und ist sinnlich ähnlich beeindruckend wie bei Noé. Wenn der kleinkriminelle Gandu gerade nicht weiblichen Derwischen in seiner von Drogen belebten Fantasie begegnet, schaut er Pornos, masturbiert oder schmeißt in wütenden Rap-Texten mit sämtlichen ihm bekannten Schimpfwörtern um sich. Der restriktiven indischen Zensur wird das ebenso wenig gefallen wie einem einsamen, moralisch empörten Zuschauer aus Indien beim Berlinale-Screening. Für zahlreiche andere Publikumsgruppen – frustrierte Jugendliche, sozial-realistische Cineasten, Freunde des Schwarz-Weiß- und Experimentalfilms – ist „Gandu“ hingegen eine großartige Entdeckung. „Berlinale 2011 – Far, far from Bollywood“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Khodorkovsky vs. Putin
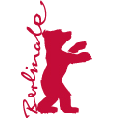 Dass Russland es nicht immer so genau mit den Menschenrechten nimmt, ist ein offenes Geheimnis. Dass Russland noch eine recht junge Wirtschaftmacht ist, ist ebenfalls bekannt. Weniger bekannt hingegen ist die Tatsache, dass Ex-Präsident und aktueller Ministerpräsident Putin einen persönlichen Feldzug gegen jene führt, die das Land vom Sozialismus in den Kapitalismus getragen und davon persönlich profitiert haben. Der bekannteste und größte Profiteur dieser Entwicklung ist wohl Mikhail Khodorkovsky, dem die gleichnamige Doku „Khodorkovsky“ auf den Zahn fühlt. Zu sechs Jahren Haft wurde Khodorkovsky verurteilt, dahinter vermutet wird ein Staatskomplott unter der Führung Putins, der Khodorkovskys Firma Yukos einst die russischen Ölquellen verkaufte, allerdings die Notbremse zog, als sich das Geschäft internationalisieren sollte, und Khodorkovsky und all die anderen Oligarchen fortan verfolgt. Der deutsche Regisseur Cyril Tuschi macht daraus eine Art Wirtschaftskrimi, der nicht nur Wegbegleiter Khodorkovskys zu Wort kommen lässt, die größtenteils ins Ausland geflüchtet sind und mit Haftbefehl von Interpol gesucht werden, sondern auch Politiker wie Joschka Fischer oder den ehemaligen russischen Wirtschaftsminister. „Khodorkovsky“ zeichnet ein düsteres Bild vom Turbokapitalismus, der dem noch jungen Russland zwar wirtschaftliche Stärke verlieh, dessen Privatisierung sich aber – geht es nach dem Kreml – als Fehler herausstellte. Dabei überrascht es immer wieder, wie schnell hier Geld zu machen war; Summen, die selbst für westliche Firmen Traumzahlen bleiben. „Berlinale 2011 – Khodorkovsky vs. Putin“ weiterlesen
Dass Russland es nicht immer so genau mit den Menschenrechten nimmt, ist ein offenes Geheimnis. Dass Russland noch eine recht junge Wirtschaftmacht ist, ist ebenfalls bekannt. Weniger bekannt hingegen ist die Tatsache, dass Ex-Präsident und aktueller Ministerpräsident Putin einen persönlichen Feldzug gegen jene führt, die das Land vom Sozialismus in den Kapitalismus getragen und davon persönlich profitiert haben. Der bekannteste und größte Profiteur dieser Entwicklung ist wohl Mikhail Khodorkovsky, dem die gleichnamige Doku „Khodorkovsky“ auf den Zahn fühlt. Zu sechs Jahren Haft wurde Khodorkovsky verurteilt, dahinter vermutet wird ein Staatskomplott unter der Führung Putins, der Khodorkovskys Firma Yukos einst die russischen Ölquellen verkaufte, allerdings die Notbremse zog, als sich das Geschäft internationalisieren sollte, und Khodorkovsky und all die anderen Oligarchen fortan verfolgt. Der deutsche Regisseur Cyril Tuschi macht daraus eine Art Wirtschaftskrimi, der nicht nur Wegbegleiter Khodorkovskys zu Wort kommen lässt, die größtenteils ins Ausland geflüchtet sind und mit Haftbefehl von Interpol gesucht werden, sondern auch Politiker wie Joschka Fischer oder den ehemaligen russischen Wirtschaftsminister. „Khodorkovsky“ zeichnet ein düsteres Bild vom Turbokapitalismus, der dem noch jungen Russland zwar wirtschaftliche Stärke verlieh, dessen Privatisierung sich aber – geht es nach dem Kreml – als Fehler herausstellte. Dabei überrascht es immer wieder, wie schnell hier Geld zu machen war; Summen, die selbst für westliche Firmen Traumzahlen bleiben. „Berlinale 2011 – Khodorkovsky vs. Putin“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Personalisierter Terror
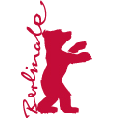 Die Idee zu Andres Veiels Spielfilmdebüt, welches die persönlichen Hintergründe zu den Terroranschlägen der RAF in den 70er-Jahren näher beleuchtet, entstand 2008 beim Lesen des Buches „Vesper, Ensslin, Baader: Urszenen des deutschen Terrorismus“ von Gerd Koenen. Veiel wollte nicht wie viele andere Filme einfach deutsche Geschichte aus rein politischer Sicht erzählen, sondern tiefer in die Seele der Aktivisten in einer Zeit des aktiven und radikalen Widerstands blicken, um eine persönliche Perspektive für die etwaigen Gründe des Widerstands in dieser radikalen Form für den Zuschauer zu ermöglichen. „Berlinale 2011 – Personalisierter Terror“ weiterlesen
Die Idee zu Andres Veiels Spielfilmdebüt, welches die persönlichen Hintergründe zu den Terroranschlägen der RAF in den 70er-Jahren näher beleuchtet, entstand 2008 beim Lesen des Buches „Vesper, Ensslin, Baader: Urszenen des deutschen Terrorismus“ von Gerd Koenen. Veiel wollte nicht wie viele andere Filme einfach deutsche Geschichte aus rein politischer Sicht erzählen, sondern tiefer in die Seele der Aktivisten in einer Zeit des aktiven und radikalen Widerstands blicken, um eine persönliche Perspektive für die etwaigen Gründe des Widerstands in dieser radikalen Form für den Zuschauer zu ermöglichen. „Berlinale 2011 – Personalisierter Terror“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Bärenstark
 Wahrheit und Schuld – um diese beiden zentralen Themen geht es in Asghar Farhadis brillantem Drama „Nader and Simin, A Separation“ („Jodaeiye Nader az Simin“). Die Wahrheit wird sich – wie in Akira Kurosawas Klassiker „Rashomon“ – als eine Frage der Perspektive erweisen. Oder anders gesagt: Als ein Puzzle, dessen einzelne Teile zusammen kein kohärentes Bild ergeben. Die Schuldfrage wiederum gestaltet sich zunehmend unentscheidbarer: In „Nader and Simin, A Separation“ gibt es nicht einfach nur gerechtfertigte oder kriminelle Handlungen, sondern auch solche, die zugleich gerechtfertigt und kriminell sein mögen. Das Justizsystem, welches über Recht und Unrecht zu entscheiden hat, offenbart angesichts solcher Veruneindeutigungen seine fundamentale Unfähigkeit, eine offene, vielschichtige Wirklichkeit nach rigide vorformulierten Paragraphen zu beurteilen. „Berlinale 2011 – Bärenstark“ weiterlesen
Wahrheit und Schuld – um diese beiden zentralen Themen geht es in Asghar Farhadis brillantem Drama „Nader and Simin, A Separation“ („Jodaeiye Nader az Simin“). Die Wahrheit wird sich – wie in Akira Kurosawas Klassiker „Rashomon“ – als eine Frage der Perspektive erweisen. Oder anders gesagt: Als ein Puzzle, dessen einzelne Teile zusammen kein kohärentes Bild ergeben. Die Schuldfrage wiederum gestaltet sich zunehmend unentscheidbarer: In „Nader and Simin, A Separation“ gibt es nicht einfach nur gerechtfertigte oder kriminelle Handlungen, sondern auch solche, die zugleich gerechtfertigt und kriminell sein mögen. Das Justizsystem, welches über Recht und Unrecht zu entscheiden hat, offenbart angesichts solcher Veruneindeutigungen seine fundamentale Unfähigkeit, eine offene, vielschichtige Wirklichkeit nach rigide vorformulierten Paragraphen zu beurteilen. „Berlinale 2011 – Bärenstark“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Blaubeuren
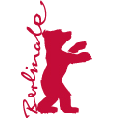 Es gibt in Werner Herzogs „Cave of Forgotten Dreams“ einen Moment, der stellvertretend für den gesamten Film steht: Es ist ein Moment, der aus nur einem Wort besteht, das zwar nicht kurz ist, aber das Herzog – der seinen Film einmal mehr selbst erzählt – so irrwitzig betont und in die Länge zieht, dass man zumindest um ein Schmunzeln nicht herumkommt: „Blaubeuren“. Herzog spricht den Namen der schwäbischen Kleinstadt in der Nähe Ulms so präzise und überspitzt genau aus, weil er genau weiß, dass sein internationales Publikum diesen Namen als belustigend erachten wird. Eine Entdeckung, die von so großer kulturhistorischer Bedeutung für die Menschheit ist, wird ausgerechnet in diesem Kaff auf der Schwäbischen Alb gefunden?
Es gibt in Werner Herzogs „Cave of Forgotten Dreams“ einen Moment, der stellvertretend für den gesamten Film steht: Es ist ein Moment, der aus nur einem Wort besteht, das zwar nicht kurz ist, aber das Herzog – der seinen Film einmal mehr selbst erzählt – so irrwitzig betont und in die Länge zieht, dass man zumindest um ein Schmunzeln nicht herumkommt: „Blaubeuren“. Herzog spricht den Namen der schwäbischen Kleinstadt in der Nähe Ulms so präzise und überspitzt genau aus, weil er genau weiß, dass sein internationales Publikum diesen Namen als belustigend erachten wird. Eine Entdeckung, die von so großer kulturhistorischer Bedeutung für die Menschheit ist, wird ausgerechnet in diesem Kaff auf der Schwäbischen Alb gefunden?
Berlinale 2011 – Rollenspiele
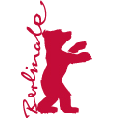 Die Deutschen machen es sich nicht leicht mit ihren Filmen über das Dritte Reich. In den meisten Fällen endet es in einer Selbstbemitleidung, die die Verbrechen auf Partei und SS schiebt und das gemeine Volk in die Opferrolle drängt. Meist rühmt man sich dann auch noch mit der Tatsache, dass alles von Historikern abgesegnet wurde und zu einhundert Prozent der Wahrheit entspricht. Inmitten dieser Produktionen, die mit Oskar Roehlers „Jud Süß – Film ohne Gewissen“ zwar einen Filmemacher fand, der sich zumindest etwas Satire zutraute, letztlich aber doch den Konventionen verfiel, sticht Wolfgang Murnbergers „Mein bester Feind“ lobenswert heraus.
Die Deutschen machen es sich nicht leicht mit ihren Filmen über das Dritte Reich. In den meisten Fällen endet es in einer Selbstbemitleidung, die die Verbrechen auf Partei und SS schiebt und das gemeine Volk in die Opferrolle drängt. Meist rühmt man sich dann auch noch mit der Tatsache, dass alles von Historikern abgesegnet wurde und zu einhundert Prozent der Wahrheit entspricht. Inmitten dieser Produktionen, die mit Oskar Roehlers „Jud Süß – Film ohne Gewissen“ zwar einen Filmemacher fand, der sich zumindest etwas Satire zutraute, letztlich aber doch den Konventionen verfiel, sticht Wolfgang Murnbergers „Mein bester Feind“ lobenswert heraus.
Berlinale 2011 – Holt den Vorschlaghammer raus
 „Medianeras“ ist einer jener Filme, die all das Mittelmaß, dem man auf einer Berlinale begegnet, vergessen lassen – ein Werk, das all die auf der Suche nach Festivalperlen erlebte Langeweile ausgleicht. In „Medianeras“ geht es um Einsamkeit, urbane Anonymität, Depressionen, Phobien und Selbstzweifel. Der argentinische Regisseur Gustavo Taretto vollbringt das kleine Wunder, diesen bedrückenden Themen enorm viel Humor abzugewinnen und ihnen dennoch in die Tiefe nachzuspüren. Sein Film nimmt die Figuren in ihrem Leid ernst und lacht verzweifelt mit ihnen statt über sie. „Medianeras“ beginnt mit einer grandiosen Collage der Architektur von Buenos Aires und fragt nach den Auswirkungen dieses Stadtbilds auf das menschliche Befinden. „Berlinale 2011 – Holt den Vorschlaghammer raus“ weiterlesen
„Medianeras“ ist einer jener Filme, die all das Mittelmaß, dem man auf einer Berlinale begegnet, vergessen lassen – ein Werk, das all die auf der Suche nach Festivalperlen erlebte Langeweile ausgleicht. In „Medianeras“ geht es um Einsamkeit, urbane Anonymität, Depressionen, Phobien und Selbstzweifel. Der argentinische Regisseur Gustavo Taretto vollbringt das kleine Wunder, diesen bedrückenden Themen enorm viel Humor abzugewinnen und ihnen dennoch in die Tiefe nachzuspüren. Sein Film nimmt die Figuren in ihrem Leid ernst und lacht verzweifelt mit ihnen statt über sie. „Medianeras“ beginnt mit einer grandiosen Collage der Architektur von Buenos Aires und fragt nach den Auswirkungen dieses Stadtbilds auf das menschliche Befinden. „Berlinale 2011 – Holt den Vorschlaghammer raus“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Let’s Dance!
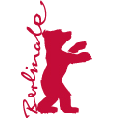 Dass ein Dokumentarfilm – und zu diesem Genre zählt Wim Wenders‘ „Pina“ – nicht immer eine stringente Erzählung oder gar einen Handlungsbogen besitzt, liegt in der Natur der Sache. Es ist einer Doku daher aber umso höher anzurechnen, wenn sie es schafft, aus einem Sujet, das für den Rezipienten bis dahin nicht von Interesse war, das Maximale rauszuholen und ihn doch bis zu einem gewissen Grade involviert. Nur ist das bei „Pina“ leider nicht der Fall.
Dass ein Dokumentarfilm – und zu diesem Genre zählt Wim Wenders‘ „Pina“ – nicht immer eine stringente Erzählung oder gar einen Handlungsbogen besitzt, liegt in der Natur der Sache. Es ist einer Doku daher aber umso höher anzurechnen, wenn sie es schafft, aus einem Sujet, das für den Rezipienten bis dahin nicht von Interesse war, das Maximale rauszuholen und ihn doch bis zu einem gewissen Grade involviert. Nur ist das bei „Pina“ leider nicht der Fall.
Berlinale 2011 – Disconnected
 Die Eltern des etwa 17-jährigen Emo-Jungen Dominik (Jakub Gierszal) sind erfolgreich, wohlhabend und attraktiv. Nur eines sind sie nicht: gute Eltern. Ihr rasanter beruflicher Aufstieg geschieht auf Kosten einer immer schwächer werdenden Verbindung zu ihrem Sohn. Dass er die Schule schwänzt, weil er dort wegen seiner homosexuellen Neigungen gemobbt wird, bemerken sie ebenso wenig wie, dass die Online-Community ‚Suicide Room‘ für ihn zum Familienersatz wird. Als Dominik sich tagelang in seinem Zimmer einschließt, reißt der Vater das DSL-Kabel aus der Wand und kappt damit auch die emotionale Verbindung komplett. Dominik kann sein Internet-Forum nicht mehr betreten und droht in seiner Verzweiflung sein Zimmer zum ‚Suicide Room‘ zu machen. Aus dem geltungssüchtigen Spiel der mit ihren vermeintlichen Selbstmordabsichten kokettierenden User wird bitterer Ernst, als Dominik tatsächlich den finalen Logout versucht. „Berlinale 2011 – Disconnected“ weiterlesen
Die Eltern des etwa 17-jährigen Emo-Jungen Dominik (Jakub Gierszal) sind erfolgreich, wohlhabend und attraktiv. Nur eines sind sie nicht: gute Eltern. Ihr rasanter beruflicher Aufstieg geschieht auf Kosten einer immer schwächer werdenden Verbindung zu ihrem Sohn. Dass er die Schule schwänzt, weil er dort wegen seiner homosexuellen Neigungen gemobbt wird, bemerken sie ebenso wenig wie, dass die Online-Community ‚Suicide Room‘ für ihn zum Familienersatz wird. Als Dominik sich tagelang in seinem Zimmer einschließt, reißt der Vater das DSL-Kabel aus der Wand und kappt damit auch die emotionale Verbindung komplett. Dominik kann sein Internet-Forum nicht mehr betreten und droht in seiner Verzweiflung sein Zimmer zum ‚Suicide Room‘ zu machen. Aus dem geltungssüchtigen Spiel der mit ihren vermeintlichen Selbstmordabsichten kokettierenden User wird bitterer Ernst, als Dominik tatsächlich den finalen Logout versucht. „Berlinale 2011 – Disconnected“ weiterlesen
Berlinale 2011 – New Historicism
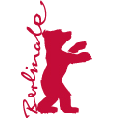 Eine moderne Inszenierung eines klassischen Stoffes ist nicht immer im Sinne der Zuschauer. Die „geupdateten“ Fassungen spalten das Publikum meist in zwei Lager: die Puristen, die einen Stoff so aufbereitet sehen wollen, wie es ursprünglich intendiert war und die Modernisten, die eine an die aktuelle Zeit angepasste Fassung stets willkommen heißen. Ralph Fiennes „Coriolanus“ ist eigentlich ein Stück aus der Feder Shakespeares (wobei wir das ja nie so sicher sagen können), eine Tragödie, die in seinem Oeuvre nicht besonders hervorsticht, auch, weil hier alles seinen gewohnten Gang geht: Verrat, Kampf, Pathos, Intrigen und Gewalt.
Eine moderne Inszenierung eines klassischen Stoffes ist nicht immer im Sinne der Zuschauer. Die „geupdateten“ Fassungen spalten das Publikum meist in zwei Lager: die Puristen, die einen Stoff so aufbereitet sehen wollen, wie es ursprünglich intendiert war und die Modernisten, die eine an die aktuelle Zeit angepasste Fassung stets willkommen heißen. Ralph Fiennes „Coriolanus“ ist eigentlich ein Stück aus der Feder Shakespeares (wobei wir das ja nie so sicher sagen können), eine Tragödie, die in seinem Oeuvre nicht besonders hervorsticht, auch, weil hier alles seinen gewohnten Gang geht: Verrat, Kampf, Pathos, Intrigen und Gewalt.
Berlinale 2011 – Coming-of-Age in der Finanzkrise
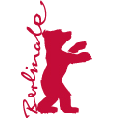 Das ganze Bankensystem sei amoralisch, sagt Jeremy Irons auf der Pressekonferenz zu „Margin Call“, vergisst dabei aber, dass nicht nur die gesamte US-Wirtschaft davon abhängig ist, sondern die Weltwirtschaft allgemein. Ohne Männer, die jeden Tag mit Millionen zocken, gäbe es keinen Wohlstand, ohne Wohlstand würde Krieg herrschen. Das behauptet Paul Bettanys Figur Will Emerson, wenn er einen jungen Nachwuchsbanker in seinem 170.000 Dollar teuren Sportwagen durch die Gegend kutschiert. Keiner will, dass das Leben fair ist, denn dann verlierst du deinen eigenen Wohlstand.
Das ganze Bankensystem sei amoralisch, sagt Jeremy Irons auf der Pressekonferenz zu „Margin Call“, vergisst dabei aber, dass nicht nur die gesamte US-Wirtschaft davon abhängig ist, sondern die Weltwirtschaft allgemein. Ohne Männer, die jeden Tag mit Millionen zocken, gäbe es keinen Wohlstand, ohne Wohlstand würde Krieg herrschen. Das behauptet Paul Bettanys Figur Will Emerson, wenn er einen jungen Nachwuchsbanker in seinem 170.000 Dollar teuren Sportwagen durch die Gegend kutschiert. Keiner will, dass das Leben fair ist, denn dann verlierst du deinen eigenen Wohlstand.
„Berlinale 2011 – Coming-of-Age in der Finanzkrise“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Geschichtsausbeutung
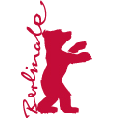 Lee Tamahori hat sich nach seinem mit viel Anerkennung bedachten „Die letzte Kriegerin“ vor allem mit Hollywood-Filmen und einer James-Bond-Verfilmung einen Namen gemacht. Er ist das, was man umgangssprachlich einen „Jobber“ nennt: Er betrachtet das Filmemachen als Job und kommt so gut wie jedem Auftrag nach. Behält man also die Tatsache im Hinterkopf, dass Tamahori quasi ein Mann der großen Studios ist, dann ist es umso erstaunlicher, welche Show er in „The Devil’s Double“ abzieht. „Berlinale 2011 – Geschichtsausbeutung“ weiterlesen
Lee Tamahori hat sich nach seinem mit viel Anerkennung bedachten „Die letzte Kriegerin“ vor allem mit Hollywood-Filmen und einer James-Bond-Verfilmung einen Namen gemacht. Er ist das, was man umgangssprachlich einen „Jobber“ nennt: Er betrachtet das Filmemachen als Job und kommt so gut wie jedem Auftrag nach. Behält man also die Tatsache im Hinterkopf, dass Tamahori quasi ein Mann der großen Studios ist, dann ist es umso erstaunlicher, welche Show er in „The Devil’s Double“ abzieht. „Berlinale 2011 – Geschichtsausbeutung“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Mit Brecht die Illusion brechen
 „Folge mir“, ein experimentelles Drama über den in völliger Apathie und Verwahrlosung endenden Zerfall einer scheinbar normalen Familie, dürfte Freunden avantgardistischer Schauspiel-Theorien gefallen – und wahrscheinlich auch fast nur diesem Zuschauer-Typus. Johannes Hammels Film merkt man die beinahe jugendlich wirkende Freude am Austoben seiner Vorstellungen von ästhetischen Provokationen deutlich an. Weder der Plot noch die Schwarz-Weiß-Bilder sind die zentralen Elemente von „Folge mir“, sondern die zahlreichen Irritationen und Verfremdungen. Dieses ständige ironische Augenzwinkern ist nicht nur anstrengend, es wirkt auch ziemlich angestrengt. „Berlinale 2011 – Mit Brecht die Illusion brechen“ weiterlesen
„Folge mir“, ein experimentelles Drama über den in völliger Apathie und Verwahrlosung endenden Zerfall einer scheinbar normalen Familie, dürfte Freunden avantgardistischer Schauspiel-Theorien gefallen – und wahrscheinlich auch fast nur diesem Zuschauer-Typus. Johannes Hammels Film merkt man die beinahe jugendlich wirkende Freude am Austoben seiner Vorstellungen von ästhetischen Provokationen deutlich an. Weder der Plot noch die Schwarz-Weiß-Bilder sind die zentralen Elemente von „Folge mir“, sondern die zahlreichen Irritationen und Verfremdungen. Dieses ständige ironische Augenzwinkern ist nicht nur anstrengend, es wirkt auch ziemlich angestrengt. „Berlinale 2011 – Mit Brecht die Illusion brechen“ weiterlesen
Berlinale 2011 – Neo-Comic-Remake-Western
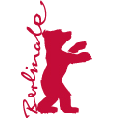 Mit Western und period pieces im Allgemeinen, ist es immer so eine Sache: Entweder man versucht auf jedes Kostüm und jeden Akzent zu achten oder man schert sich erst gar nicht darum und verkehrt die Topoi sogar. Bei „True Grit“ ist das größte Problem, das er sich nicht entscheiden kann, welche Richtung er eigentlich einschlagen will. Da präsentieren uns die Coen-Brüder tolle Landschaftsaufnahmen, die Kameramann Roger Deakins perfekt in Szene zu setzen weiß, lassen Jeff Bridges einen Akzent sprechen, der brutaler kaum sein könnte und zeigen Männer, die noch Männer sind. Und dazwischen: ein cooler Spruch nach dem anderen, der mindestens so locker über die Lippen kommen soll wie der Colt aus dem Holster gezogen wird.
Mit Western und period pieces im Allgemeinen, ist es immer so eine Sache: Entweder man versucht auf jedes Kostüm und jeden Akzent zu achten oder man schert sich erst gar nicht darum und verkehrt die Topoi sogar. Bei „True Grit“ ist das größte Problem, das er sich nicht entscheiden kann, welche Richtung er eigentlich einschlagen will. Da präsentieren uns die Coen-Brüder tolle Landschaftsaufnahmen, die Kameramann Roger Deakins perfekt in Szene zu setzen weiß, lassen Jeff Bridges einen Akzent sprechen, der brutaler kaum sein könnte und zeigen Männer, die noch Männer sind. Und dazwischen: ein cooler Spruch nach dem anderen, der mindestens so locker über die Lippen kommen soll wie der Colt aus dem Holster gezogen wird.
Berlinale 2011 – Norwegische Seelenlandschaften
 Zwei Frauen wandern durch eine einsame, verschneite Bergwelt. Noch bevor die ersten Worte gesprochen werden, grundiert die seelische Zustände reflektierende Landschaft die Stimmung des Films und charakterisiert zugleich die Figuren. Die winterlich-kalten Farben Weiß und Blau dominieren die Palette und deuten das zentrale Problem von Solveig (Ellen Dorrit Petersen ) und Nora (Marte Magnusdotter Solem) metaphorisch an: Die Beziehung der beiden ist eingefroren, eine eisige Decke des Schweigens hat sich über ihr Miteinander gelegt. Ein am Beginn noch chiffriertes Bild wird ein zweites Mal im Film auftauchen und den Grund der Beziehungsprobleme aufzeigen. In „The Mountain“ („Fjellet“) geht es nicht etwa um ein allmähliches emotionales Erkalten durch Alltagsroutine. Ganz im Gegenteil: Es gibt einen abrupten, datierbaren Bruch. Solveig und Nora sind diesen Weg schon einmal gegangen, damals mit ihrem gemeinsamen Sohn Vetle – zurück gekehrt sind damals nur die beiden Frauen. „Berlinale 2011 – Norwegische Seelenlandschaften“ weiterlesen
Zwei Frauen wandern durch eine einsame, verschneite Bergwelt. Noch bevor die ersten Worte gesprochen werden, grundiert die seelische Zustände reflektierende Landschaft die Stimmung des Films und charakterisiert zugleich die Figuren. Die winterlich-kalten Farben Weiß und Blau dominieren die Palette und deuten das zentrale Problem von Solveig (Ellen Dorrit Petersen ) und Nora (Marte Magnusdotter Solem) metaphorisch an: Die Beziehung der beiden ist eingefroren, eine eisige Decke des Schweigens hat sich über ihr Miteinander gelegt. Ein am Beginn noch chiffriertes Bild wird ein zweites Mal im Film auftauchen und den Grund der Beziehungsprobleme aufzeigen. In „The Mountain“ („Fjellet“) geht es nicht etwa um ein allmähliches emotionales Erkalten durch Alltagsroutine. Ganz im Gegenteil: Es gibt einen abrupten, datierbaren Bruch. Solveig und Nora sind diesen Weg schon einmal gegangen, damals mit ihrem gemeinsamen Sohn Vetle – zurück gekehrt sind damals nur die beiden Frauen. „Berlinale 2011 – Norwegische Seelenlandschaften“ weiterlesen
The Legend of Su
 Die Geschichte des Bettlers Su, der als großer Wushu-Meister nach der Ermordung seiner Frau dem Wahnsinn verfällt, aus der Irrationalität seines vernebelten Geistes heraus jedoch den „Drunken Fist“-Stil entwickelt und somit die Welt der Kampfkunst revolutioniert, zählt zu den klassischen Stoffen der chinesischen Kung-Fu-Folklore und wurde bereits mehrfach auf die Kinoleinwände gebracht, in Gestalt von großen Stars wie Chow Yun-Fat, Donnie Yen oder Stephen Chow. Auch Regisseur Yuen Woo-Ping, der 1978 mit dem Klassiker „Drunken Master“ schon einmal eine komödiantische Variation auf den Stoff vorlegte und damit einem jungen Kampfkünstler namens Jackie Chan zum Durchbruch verhalf, versucht sich nun mit „True Legend“ erneut an einer kinematographischen Umsetzung der Legende. Für den großen Choreographen bedeutet dies die Rückkehr auf den Regisseursstuhl nach 14 Jahren, und die allzu oft auf Sparflamme gesetzten Anhänger des Martial-Arts-Kinos erkoren „True Legend“ sehr bald zum großen Hoffnungsträger des chinesischen Kinojahres. Löst der Film, der sich zudem noch mit dem Titel des ersten chinesischen Digital-3D-Films schmücken kann, diese hochgesteckten Hoffnungen aber auch tatsächlich ein?
Die Geschichte des Bettlers Su, der als großer Wushu-Meister nach der Ermordung seiner Frau dem Wahnsinn verfällt, aus der Irrationalität seines vernebelten Geistes heraus jedoch den „Drunken Fist“-Stil entwickelt und somit die Welt der Kampfkunst revolutioniert, zählt zu den klassischen Stoffen der chinesischen Kung-Fu-Folklore und wurde bereits mehrfach auf die Kinoleinwände gebracht, in Gestalt von großen Stars wie Chow Yun-Fat, Donnie Yen oder Stephen Chow. Auch Regisseur Yuen Woo-Ping, der 1978 mit dem Klassiker „Drunken Master“ schon einmal eine komödiantische Variation auf den Stoff vorlegte und damit einem jungen Kampfkünstler namens Jackie Chan zum Durchbruch verhalf, versucht sich nun mit „True Legend“ erneut an einer kinematographischen Umsetzung der Legende. Für den großen Choreographen bedeutet dies die Rückkehr auf den Regisseursstuhl nach 14 Jahren, und die allzu oft auf Sparflamme gesetzten Anhänger des Martial-Arts-Kinos erkoren „True Legend“ sehr bald zum großen Hoffnungsträger des chinesischen Kinojahres. Löst der Film, der sich zudem noch mit dem Titel des ersten chinesischen Digital-3D-Films schmücken kann, diese hochgesteckten Hoffnungen aber auch tatsächlich ein?
Mein Leben als Kriegsgott
 Das also ist es, was der Krieg vom Menschen übrig lässt. Nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg bleibt vom hochdekorierten Offizier Kurokawa nur ein arm- und beinamputiertes, sabberndes, entstelltes und zur Artikulation kaum fähiges Stück Mensch zurück, mit ein paar salbungsvollen Worten und einer Urkunde, die ihn zum „Kriegsgott“ erklärt, bei seiner entsetzten Familie abgeladen. Nachdem sie den ersten Ansatz, ihren Gatten (und vor allem: sich selbst) von seinem Leid zu erlösen, verwirft, beschließt Kurokawas Ehefrau Shigeko, sich fortan um das hilflose Wrack zu kümmern. Sie findet ihren Mann dabei zurückgeworfen auf seine nackte Körperlichkeit: Schlafen, Essen, Pissen, Ficken. Mehr bleibt nicht von Kurokawa, nachdem er vom Krieg vereinnahmt, gefressen, kastriert wurde. Letzteres freilich, darin liegt die böseste Pointe hier, nur symbolisch, an Armen, Beinen und Handlungsmacht. Der Penis bleibt, ebenso wie der bloße Trieb, und der Mensch in der Welt von Kôji Wakamatsu findet sich radikal darauf reduziert.
Das also ist es, was der Krieg vom Menschen übrig lässt. Nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg bleibt vom hochdekorierten Offizier Kurokawa nur ein arm- und beinamputiertes, sabberndes, entstelltes und zur Artikulation kaum fähiges Stück Mensch zurück, mit ein paar salbungsvollen Worten und einer Urkunde, die ihn zum „Kriegsgott“ erklärt, bei seiner entsetzten Familie abgeladen. Nachdem sie den ersten Ansatz, ihren Gatten (und vor allem: sich selbst) von seinem Leid zu erlösen, verwirft, beschließt Kurokawas Ehefrau Shigeko, sich fortan um das hilflose Wrack zu kümmern. Sie findet ihren Mann dabei zurückgeworfen auf seine nackte Körperlichkeit: Schlafen, Essen, Pissen, Ficken. Mehr bleibt nicht von Kurokawa, nachdem er vom Krieg vereinnahmt, gefressen, kastriert wurde. Letzteres freilich, darin liegt die böseste Pointe hier, nur symbolisch, an Armen, Beinen und Handlungsmacht. Der Penis bleibt, ebenso wie der bloße Trieb, und der Mensch in der Welt von Kôji Wakamatsu findet sich radikal darauf reduziert.
„Mein Leben als Kriegsgott“ weiterlesen
Enter Metalopolis
 Die nahe Zukunft: das Internet und seine virtuelle Community OZ sind zur veritablen Parallelgesellschaft geworden. Unternehmen betreiben Zweigstellen im Digitaluniversum, Geschäfte werden dort getätigt, Behörden verwaltet – der Cyberspace ist untrennbar mit der Außenwelt verzahnt. Ein klassisches Szenario des jüngeren Science-Fiction-Kinos, das man jedoch so, wie es Mamoru Hosoda in seinem Anime „Summer Wars“ umsetzt, noch nie gesehen hat.
Die nahe Zukunft: das Internet und seine virtuelle Community OZ sind zur veritablen Parallelgesellschaft geworden. Unternehmen betreiben Zweigstellen im Digitaluniversum, Geschäfte werden dort getätigt, Behörden verwaltet – der Cyberspace ist untrennbar mit der Außenwelt verzahnt. Ein klassisches Szenario des jüngeren Science-Fiction-Kinos, das man jedoch so, wie es Mamoru Hosoda in seinem Anime „Summer Wars“ umsetzt, noch nie gesehen hat.
… oder der Spatz in der Hand?
 Koto und Kyoko sind zwei Endzwanziger im Stadtteil Uzumasa der Stadt Kyoto, in dem bereits ihre Eltern aufgewachsen sind und ihr Leben gestaltet haben. Kotos Eltern betreiben eine Tofuproduktion, während Kyokos Familie eine Wäscherei besitzt; die beiden Familien führen ein bodenständiges, harmonisches Leben. Doch obwohl Koto und Kyoko mitten im Leben stehen, scheint ihr Weg noch nicht ganz gefunden. Besonders Koto ist unzufrieden mit seinem Dasein, denn seine Lebensplanung scheint nicht aufzugehen.
Koto und Kyoko sind zwei Endzwanziger im Stadtteil Uzumasa der Stadt Kyoto, in dem bereits ihre Eltern aufgewachsen sind und ihr Leben gestaltet haben. Kotos Eltern betreiben eine Tofuproduktion, während Kyokos Familie eine Wäscherei besitzt; die beiden Familien führen ein bodenständiges, harmonisches Leben. Doch obwohl Koto und Kyoko mitten im Leben stehen, scheint ihr Weg noch nicht ganz gefunden. Besonders Koto ist unzufrieden mit seinem Dasein, denn seine Lebensplanung scheint nicht aufzugehen.

