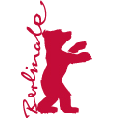 Dass ein Dokumentarfilm – und zu diesem Genre zählt Wim Wenders‘ „Pina“ – nicht immer eine stringente Erzählung oder gar einen Handlungsbogen besitzt, liegt in der Natur der Sache. Es ist einer Doku daher aber umso höher anzurechnen, wenn sie es schafft, aus einem Sujet, das für den Rezipienten bis dahin nicht von Interesse war, das Maximale rauszuholen und ihn doch bis zu einem gewissen Grade involviert. Nur ist das bei „Pina“ leider nicht der Fall.
Dass ein Dokumentarfilm – und zu diesem Genre zählt Wim Wenders‘ „Pina“ – nicht immer eine stringente Erzählung oder gar einen Handlungsbogen besitzt, liegt in der Natur der Sache. Es ist einer Doku daher aber umso höher anzurechnen, wenn sie es schafft, aus einem Sujet, das für den Rezipienten bis dahin nicht von Interesse war, das Maximale rauszuholen und ihn doch bis zu einem gewissen Grade involviert. Nur ist das bei „Pina“ leider nicht der Fall.
Errol Morris‘ „Gates of Heaven“ ist hierfür ein Paradebeispiel, schafft es Morris doch, die Thematik so zu aufzubereiten, dass auch dem größten Tierfeind warm ums Herz wird. Wim Wenders‘ „Pina“ lebt einerseits von seinen bisweilen interessanten Tanz- und Showeinlagen, die viel Kraft und Übung kosten, was man den Tänzern zu jeder Sekunde auch ansieht. Das Problem ist dabei nur: die immer und immer wieder gleichen Abläufe und Inszenierungen, die sich teilweise nur marginal voneinander unterscheiden, werden so schnell redundant und schwermütig, dass man die Leistung der Tänzer bald nicht mehr anerkennt. Auch sind die Showeinlagen, die mal an klassisches Ballett, mal an modernen Tanz und mal an Performance-Kunst erinnern, sehr prätentiös geraten, was dem Ganzen zu einem gewissen Maße natürlich inhärent ist.
Auch auf formaler Ebene schafft es Wenders nicht von der bloßen Prätention wegzukommen und stellt die Tänzer mit Voice-Over vor und lässt sie dabei bedeutungsschwanger in die Kamera schauen. Auch mit dem, was sie von sich geben, tun sich die Beteiligten keinen Gefallen. Einerseits klingt das, was sie artikulieren, stark nach Esoterik und Morgen-Yoga aus dem öffentlich-rechtlichen TV, andererseits verkommt der Film dadurch auch zu einer reinen Lobhudelei auf Pina Bausch, die nicht nur zu einer unglaublichen Quelle der Inspiration ernannt wird, sondern ferner auch als Mutter für alle in der Company diente (was an und für sich ja kein Negativkriterium darstellt, nach der x-ten Wiederholung aber nervtötend ist). Bleibt noch die 3D-Technik, derer sich Wenders‘ Film auch nicht gerade geschickt bedient. Die meiste Zeit über ist seine Kamera nämlich eher starr, das Einzige, das sich wirklich bewegt, sind die Tänzer. Natürlich gibt es hier und da einen Stuhl, der ins Publikum ragt oder ein Tuch, das hin und her schwingt, aber das war es dann auch schon mit dem Mehrwert der Technik in Wenders‘ „Pina“. Man muss Pina Bauschs Arbeit wohl zutiefst lieben, um auch an dieser „Pina“ etwas zu finden. Als Musical, Biopic oder gar Tanzfilm taugt „Pina“ nämlich so gar nicht. Vielmehr ist der Film eine lose Aneinanderreihungen von Kommentaren, Tanzeinlagen und Assoziationen zu Pina. Und das ist selbst für eine Doku viel zu wenig.

