Derrida, USA 2003, Amy Ziering Kofman/Kirby Dick
Der französische Philosoph Jacques Derrida gilt als einer bedeutendsten Denker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit 1967 veröffentlicht er kontinuierlich philosophische Bücher und Aufsätze, die in akademischen Kreisen (aber auch im Feuilleton) – vornehmlich in der Philosophie, der Literaturwissenschaft und den Kulturwissenschaften, aber auch in Bereichen wie der Architektur oder dem Ballett –, lebhaft rezipiert werden. Bekannt geworden ist Derrida als Begründer des so genannten ‚Dekonstruktivismus‘, einer Überbietung der Heideggerschen ‚Destruktion‘ der abendländischen Metaphysik (vgl. Sein und Zeit, § 6), die sich darauf besinnt, dass man der Tradition nicht so ohne weiteres entkommt (wie Heidegger selbst gehofft hatte), und folglich aus ihr heraus und in ihr operiert: Die Tradition wird nicht einfach zerstört, sondern zerlegt und umgebaut; dem destruierenden Gestus ist auch etwas Konstruktives zu eigen. Die De(kon)struktion Derridas meint mithin eine Lektüre philosophischer Texte, die nicht nur auslegt, was der Text sagt (das wäre Hermeneutik), sondern auch auslegt, was er nicht sagt, was er verschweigt. Durch solche Lektüren legt der französische Denker die Hypotheken frei, die auf der abendländischen Philosophie lasten: Sie ist seit Platon logozentrisch (d.h. auf das gesprochene Wort fixiert), phallozentrisch (d.h. männlich dominiert) und ethnozentrisch (westeuropäisch geprägt). Gegen die von ihm auch als Präsenzmetaphysik bezeichnete Tradition setzt er ein Denken, das sich über die Beschränkungen, denen unser Welt- und Wahrheitszugang unterliegt, völlig im Klaren ist: Sinn gibt es nicht präsent, sondern immer nur aufgeschoben. Alle Präsenz ist eine abgeleitete. „Die unmögliche Biografie“ weiterlesen
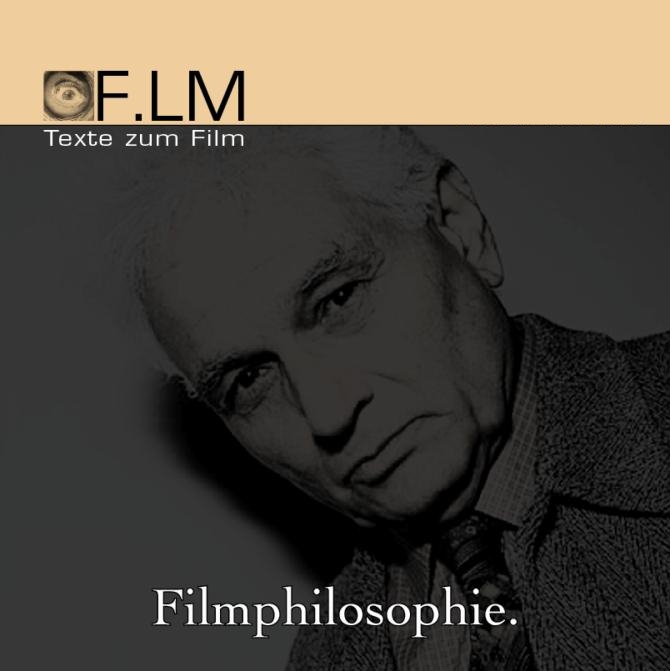


 In den 1980er Jahren sind in den Geistes- und Kulturwissenschaften alte Theorieparadigmen umgestürzt und neue errichtet worden. Strukturale Psychoanalyse, Postmoderne, Poststrukturalismus, Diskursanalyse, Dekonstruktion, New Historicism und andere Theoriebewegungen haben das Denken und Schreiben der deutschen Geisteswissenschaften radikal verändert und erst die Kultur- und Medienwissenschaften ermöglicht, wie wir sie heute kennen. Zwei jüngere Theoriestränge sind dabei spezifisch deutsche Formationen, und erst seit kurzer Zeit wird deutlich, wie hoch ihr Einfluss auf das gesamte Spektrum von Philosophie, Soziologie, Literatur-, Film- und Medienwissenschaften ist.
In den 1980er Jahren sind in den Geistes- und Kulturwissenschaften alte Theorieparadigmen umgestürzt und neue errichtet worden. Strukturale Psychoanalyse, Postmoderne, Poststrukturalismus, Diskursanalyse, Dekonstruktion, New Historicism und andere Theoriebewegungen haben das Denken und Schreiben der deutschen Geisteswissenschaften radikal verändert und erst die Kultur- und Medienwissenschaften ermöglicht, wie wir sie heute kennen. Zwei jüngere Theoriestränge sind dabei spezifisch deutsche Formationen, und erst seit kurzer Zeit wird deutlich, wie hoch ihr Einfluss auf das gesamte Spektrum von Philosophie, Soziologie, Literatur-, Film- und Medienwissenschaften ist.