 Es ist ein bisschen absurd mit der Pornofilmrezeption. Seit Jahrzehnten ist der Pornofilm im Grunde allgegenwärtig; so manche Videothek wurde und wird von ihm und im Grunde zumeist nur von ihm am Leben erhalten, und während Eltern, Studienräte und Medienapokalyptiker in seiner erleichterten Zugänglichkeit per World Wide Web den Grundstein für die ganz sicher anstehende endgültige Verrohung der zur Zeit pubertierenden Nachkommenschaft zu erkennen meinen – warum hat eigentlich Michael Haneke noch keinen Film darüber gemacht? – ergreifen und umarmen ihn Subkultur, kulturelle Avantgarde und jedwede sexuelle Emanzipationsbewegung aus den Zwischen- und Grauzonen des queeren Spektrums immer wieder aufs Neue. Das Wort von der „Generation Porno“ macht inzwischen schon so lang immer wieder aufs Neue die Runde, dass sich eigentlich schon mehrere Generationen davon angesprochen fühlen müssten, und seit einigen Jahren experimentiert das (vom Rezensenten mitkuratierte) Pornfilmfestival Berlin jährlich mit immer wieder neuen Verschiebungen und Erweiterungen des Blickes auf die explizite Darstellung von Sexualität im Film, aus kommerzpornografischer wie aus dezidiert künstlerischer Perspektive kommend.
Es ist ein bisschen absurd mit der Pornofilmrezeption. Seit Jahrzehnten ist der Pornofilm im Grunde allgegenwärtig; so manche Videothek wurde und wird von ihm und im Grunde zumeist nur von ihm am Leben erhalten, und während Eltern, Studienräte und Medienapokalyptiker in seiner erleichterten Zugänglichkeit per World Wide Web den Grundstein für die ganz sicher anstehende endgültige Verrohung der zur Zeit pubertierenden Nachkommenschaft zu erkennen meinen – warum hat eigentlich Michael Haneke noch keinen Film darüber gemacht? – ergreifen und umarmen ihn Subkultur, kulturelle Avantgarde und jedwede sexuelle Emanzipationsbewegung aus den Zwischen- und Grauzonen des queeren Spektrums immer wieder aufs Neue. Das Wort von der „Generation Porno“ macht inzwischen schon so lang immer wieder aufs Neue die Runde, dass sich eigentlich schon mehrere Generationen davon angesprochen fühlen müssten, und seit einigen Jahren experimentiert das (vom Rezensenten mitkuratierte) Pornfilmfestival Berlin jährlich mit immer wieder neuen Verschiebungen und Erweiterungen des Blickes auf die explizite Darstellung von Sexualität im Film, aus kommerzpornografischer wie aus dezidiert künstlerischer Perspektive kommend.
„Take a look into the incredible mirror of lust!“ weiterlesen


 Die Apokalypse beginnt in Moabit. Dabei sollte es doch so schön werden: der 35jährige Wiener Michi (Michael Fuith) kommt nach Berlin, um seine große Liebe Gabi (Anka Graczyk) zurückzugewinnen, trifft jedoch in ihrer Wohnung im Bezirk mit dem spröden Westberliner Charme lediglich zwei Handwerker an. Und dann kommen die Zombies. Bald findet sich Michi mit dem 15jährigen Harper (Theo Trebs) hinter verbarrikadierter Wohnungstür wieder, während draußen die Infizierten toben. Um eine Viruserkrankung handelt es sich, per Biss übertragbar – das entschuldigt dann auch die enorme Agilität der Zombies, die in Marvin Krens „Rammbock“ mal wieder, dem Zeitgeist entsprechend, rennen dürfen. Zum Ausbruch kommt die Krankheit jedoch nicht sofort, sondern erst durch die Ausschüttung von Adrenalin im Körper des Infizierten. Folglich heißt es vor allem: Ruhe bewahren, auch im Angesicht der aggressiven Horden im Innenhof. Wie gut, dass Michi ohnehin über ein eher lakonisches, ausgeglichenes Naturell verfügt…
Die Apokalypse beginnt in Moabit. Dabei sollte es doch so schön werden: der 35jährige Wiener Michi (Michael Fuith) kommt nach Berlin, um seine große Liebe Gabi (Anka Graczyk) zurückzugewinnen, trifft jedoch in ihrer Wohnung im Bezirk mit dem spröden Westberliner Charme lediglich zwei Handwerker an. Und dann kommen die Zombies. Bald findet sich Michi mit dem 15jährigen Harper (Theo Trebs) hinter verbarrikadierter Wohnungstür wieder, während draußen die Infizierten toben. Um eine Viruserkrankung handelt es sich, per Biss übertragbar – das entschuldigt dann auch die enorme Agilität der Zombies, die in Marvin Krens „Rammbock“ mal wieder, dem Zeitgeist entsprechend, rennen dürfen. Zum Ausbruch kommt die Krankheit jedoch nicht sofort, sondern erst durch die Ausschüttung von Adrenalin im Körper des Infizierten. Folglich heißt es vor allem: Ruhe bewahren, auch im Angesicht der aggressiven Horden im Innenhof. Wie gut, dass Michi ohnehin über ein eher lakonisches, ausgeglichenes Naturell verfügt… Das auf der Grundlage lizenzierter Vorlagen aus dem weiten Feld der Populärkultur programmierte Videospiel genießt nicht unbedingt den besten Ruf: Mit der heißen Nadel angesichts einer per Crosspromotion festgelegten Deadline gestrickt, scheinen seine meist an aktuellen Kinoveröffentlichungen ausgerichteten Exempel allzu oft nicht so recht zu Ende gedacht, scheint das Spieldesign dahin geschludert oder die Technik unperfekt. Auch die beiden Comicsuperhelden Batman und Spider-Man litten schon in schöner Regelmäßigkeit unter diesen Mängeln in nahezu unzähligen Videospielinkarnationen, die ihre diversen, mehr oder minder avancierten Kinoauftritte eskortierten – von Burton über Schumacher bis Nolan auf der einen, von Raimi über Raimi bis Raimi auf der anderen Seite.
Das auf der Grundlage lizenzierter Vorlagen aus dem weiten Feld der Populärkultur programmierte Videospiel genießt nicht unbedingt den besten Ruf: Mit der heißen Nadel angesichts einer per Crosspromotion festgelegten Deadline gestrickt, scheinen seine meist an aktuellen Kinoveröffentlichungen ausgerichteten Exempel allzu oft nicht so recht zu Ende gedacht, scheint das Spieldesign dahin geschludert oder die Technik unperfekt. Auch die beiden Comicsuperhelden Batman und Spider-Man litten schon in schöner Regelmäßigkeit unter diesen Mängeln in nahezu unzähligen Videospielinkarnationen, die ihre diversen, mehr oder minder avancierten Kinoauftritte eskortierten – von Burton über Schumacher bis Nolan auf der einen, von Raimi über Raimi bis Raimi auf der anderen Seite. In der Bundesrepublik der 1980er Jahre kannte Didi Hallervorden jedes Kind. Mit dieser Kunstfigur hatte der zuvor vor allem als politischer Kabarettist auftretende Dieter Hallervorden ein Alter Ego erschaffen, das zum größten Erfolg seiner Karriere und ihm in gewisser Hinsicht auch zum Fluch wurde. Nach seinem Durchbruch in der Rolle des wild grimassierenden Anarcho-Clowns Didi, die im Verlauf der überaus erfolgreichen TV-Serie Nonstop Nonsens (1975-1980) herausgearbeitet wurde, war Hallervorden an diesen sehr klar definierten Rollentypus gebunden, und der zuvor auch durchaus in mehr oder minder seriösen Rollen überzeugende Charakterdarsteller, der sein Kinodebüt in Fritz Langs letztem Film Die 1000 Augen des Dr. Mabuse feierte und später mit Tom Toelle und Roman Polanski drehte, war auf ewig auf die Comedy festgelegt – bevor es so etwas wie Comedy in Deutschland überhaupt gab.
In der Bundesrepublik der 1980er Jahre kannte Didi Hallervorden jedes Kind. Mit dieser Kunstfigur hatte der zuvor vor allem als politischer Kabarettist auftretende Dieter Hallervorden ein Alter Ego erschaffen, das zum größten Erfolg seiner Karriere und ihm in gewisser Hinsicht auch zum Fluch wurde. Nach seinem Durchbruch in der Rolle des wild grimassierenden Anarcho-Clowns Didi, die im Verlauf der überaus erfolgreichen TV-Serie Nonstop Nonsens (1975-1980) herausgearbeitet wurde, war Hallervorden an diesen sehr klar definierten Rollentypus gebunden, und der zuvor auch durchaus in mehr oder minder seriösen Rollen überzeugende Charakterdarsteller, der sein Kinodebüt in Fritz Langs letztem Film Die 1000 Augen des Dr. Mabuse feierte und später mit Tom Toelle und Roman Polanski drehte, war auf ewig auf die Comedy festgelegt – bevor es so etwas wie Comedy in Deutschland überhaupt gab.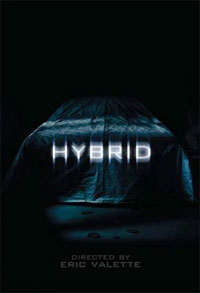
 Eine Kinoadaption von „Astro Boy“ ist nicht einfach nur eine weitere Mangaverfilmung, schon gar nicht, wenn sie aus Hollywood kommt. Osamu Tezukas 1952 erschaffener Roboterjunge ist kein austauschbarer Comicheld von der Stange, sondern kommt in seiner Bedeutung für die japanische Populärkultur der vergangenen sechs Dekaden der Popularität einer Mickey Mouse im Einflussbereich der US-amerikanischen Kulturhegemonie gleich. Ein Hauptwerk der Mangakultur und ihres bedeutenden Autoren Tezuka, dessen verschiedene Animeadaptionen – eine Serie in den 1960er-Jahren, ein Remake in den 1980er-Jahren sowie ein weiteres in den 2000ern – auch außerhalb Japans erfolgreich waren und die japanische Animationsfilmkultur weltweit populär zu machen halfen. Eine Kinoadaption als Hollywoodproduktion, also in einen völlig unterschiedlichen kulturellen Rahmen gerückt, ist im Grunde bereits ein kontroverses Vorhaben; man erinnere sich nur um die Debatten um Roland Emmerichs amerikanisierten „Godzilla“, für den die Japaner, jüngere Seitenhiebe aus den kaiju eiga von Shusuke Kaneko oder Ryuhei Kitamura zeigen es überdeutlich, bis heute nur Spott und Geringschätzung übrig haben. Entschärft wird dieser unweigerliche Konflikt um Deutungshoheit und kulturelles Nationalerbe auch sicher nicht durch den Umstand, dass sich die seit Jahren hypererfolgreiche Animationsfilmkultur der USA grundlegend und unversöhnlich von der japanischen unterscheidet.
Eine Kinoadaption von „Astro Boy“ ist nicht einfach nur eine weitere Mangaverfilmung, schon gar nicht, wenn sie aus Hollywood kommt. Osamu Tezukas 1952 erschaffener Roboterjunge ist kein austauschbarer Comicheld von der Stange, sondern kommt in seiner Bedeutung für die japanische Populärkultur der vergangenen sechs Dekaden der Popularität einer Mickey Mouse im Einflussbereich der US-amerikanischen Kulturhegemonie gleich. Ein Hauptwerk der Mangakultur und ihres bedeutenden Autoren Tezuka, dessen verschiedene Animeadaptionen – eine Serie in den 1960er-Jahren, ein Remake in den 1980er-Jahren sowie ein weiteres in den 2000ern – auch außerhalb Japans erfolgreich waren und die japanische Animationsfilmkultur weltweit populär zu machen halfen. Eine Kinoadaption als Hollywoodproduktion, also in einen völlig unterschiedlichen kulturellen Rahmen gerückt, ist im Grunde bereits ein kontroverses Vorhaben; man erinnere sich nur um die Debatten um Roland Emmerichs amerikanisierten „Godzilla“, für den die Japaner, jüngere Seitenhiebe aus den kaiju eiga von Shusuke Kaneko oder Ryuhei Kitamura zeigen es überdeutlich, bis heute nur Spott und Geringschätzung übrig haben. Entschärft wird dieser unweigerliche Konflikt um Deutungshoheit und kulturelles Nationalerbe auch sicher nicht durch den Umstand, dass sich die seit Jahren hypererfolgreiche Animationsfilmkultur der USA grundlegend und unversöhnlich von der japanischen unterscheidet.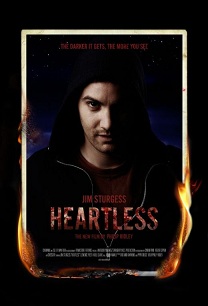

 Was einst ein archaisches Initiations- und Bewährungsritual war, das ist heute zum flachen, enthemmten Besäufnis entleert worden. Der Junggesellenabschied, so erfahren wir an exponierter Stelle in Peter A. Dowlings Horrorfilm „Stag Night“, geht auf ein Jagdritual archaischer Stämme zurück, die den Bräutigam vor der Hochzeit auf die Hirschjagd schickte – und somit in einen Kampf auf Leben und Tod. Erlegte der junge Mann das Tier, erwies er sich somit seiner Braut als würdig; gelang es ihm nicht, so ließ er sein Leben in diesem Duell auf Augenhöhe. In einen Kampf auf Leben und Tod stolpern auch die Freunde Mike, Carl und Joe, die gemeinsam mit Mikes Bruder Tony den Junggesellenabschied von Mike feiern wollen – obgleich sich der Ehemann in spe seiner Sache gar nicht mehr so ganz sicher ist, scheint ihm doch der eigene Lebensweg zu glatt und ungebrochen.
Was einst ein archaisches Initiations- und Bewährungsritual war, das ist heute zum flachen, enthemmten Besäufnis entleert worden. Der Junggesellenabschied, so erfahren wir an exponierter Stelle in Peter A. Dowlings Horrorfilm „Stag Night“, geht auf ein Jagdritual archaischer Stämme zurück, die den Bräutigam vor der Hochzeit auf die Hirschjagd schickte – und somit in einen Kampf auf Leben und Tod. Erlegte der junge Mann das Tier, erwies er sich somit seiner Braut als würdig; gelang es ihm nicht, so ließ er sein Leben in diesem Duell auf Augenhöhe. In einen Kampf auf Leben und Tod stolpern auch die Freunde Mike, Carl und Joe, die gemeinsam mit Mikes Bruder Tony den Junggesellenabschied von Mike feiern wollen – obgleich sich der Ehemann in spe seiner Sache gar nicht mehr so ganz sicher ist, scheint ihm doch der eigene Lebensweg zu glatt und ungebrochen. 
 „Ich freue mich sehr, dem Land Israel geholfen zu haben, einem Nazi das Leben zu retten“ – eine Komödie, in der solche Dialogsätze fallen dürfen, kann nicht ganz schlecht sein, und tatsächlich gehört Michel Hazanavicius’ Sequel zu seinem eigenen Erfolgsfilm „
„Ich freue mich sehr, dem Land Israel geholfen zu haben, einem Nazi das Leben zu retten“ – eine Komödie, in der solche Dialogsätze fallen dürfen, kann nicht ganz schlecht sein, und tatsächlich gehört Michel Hazanavicius’ Sequel zu seinem eigenen Erfolgsfilm „

 Was wäre das Kino ohne seine großen Mythen von den Unvollendeten? Von den Meisterwerken, die es nie gegeben hat und die doch Lücken lassen, welche mit den Sehnsüchten all jener, die das Kino lieben, gefüllt werden? Kubricks „Napoleon“, Tarkovskijs „Hamlet“, Welles’ oder Gilliams „Don Quixote“ – oder die ursprüngliche, neunstündige Fassung von Stroheims „Greed“? Der legendenumwobene sechsstündige Rohschnitt von Ciminos „Heaven’s Gate“, oder ein echter Director’s Cut von Scorseses „Gangs of New York“? Die Träume, die an diesen Lücken hängen, sind stets so übergroß, dass kein Film ihnen jemals gerecht werden könnte, und fast scheint es, als wäre das Kino als Projektionsfläche für solcherlei Träume am wirksamsten dort, wo es gar keinen Film mehr projiziert.
Was wäre das Kino ohne seine großen Mythen von den Unvollendeten? Von den Meisterwerken, die es nie gegeben hat und die doch Lücken lassen, welche mit den Sehnsüchten all jener, die das Kino lieben, gefüllt werden? Kubricks „Napoleon“, Tarkovskijs „Hamlet“, Welles’ oder Gilliams „Don Quixote“ – oder die ursprüngliche, neunstündige Fassung von Stroheims „Greed“? Der legendenumwobene sechsstündige Rohschnitt von Ciminos „Heaven’s Gate“, oder ein echter Director’s Cut von Scorseses „Gangs of New York“? Die Träume, die an diesen Lücken hängen, sind stets so übergroß, dass kein Film ihnen jemals gerecht werden könnte, und fast scheint es, als wäre das Kino als Projektionsfläche für solcherlei Träume am wirksamsten dort, wo es gar keinen Film mehr projiziert.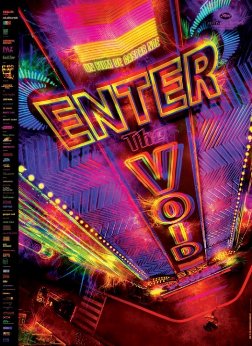
 Mit „Universal Soldier“ von 1992 hat der schwäbische Blockbusterregisseur Roland Emmerich seinen vielleicht einzigen wirklich intelligenten Film geschaffen. Im Gegensatz zu späteren, ultrateuren Werken wie den (natürlich gleichwohl großartigen) apokalyptischen Opern
Mit „Universal Soldier“ von 1992 hat der schwäbische Blockbusterregisseur Roland Emmerich seinen vielleicht einzigen wirklich intelligenten Film geschaffen. Im Gegensatz zu späteren, ultrateuren Werken wie den (natürlich gleichwohl großartigen) apokalyptischen Opern  Bereits in Kwak Jae-Youngs Kinodebüt „My Sassy Girl“ (2001), zur Hochphase der koreanischen New Wave um die Jahrtausendwende entstanden und seither zum viel geliebten Klassiker avanciert, gibt es ein Filmdrehbuch mit dem Titel „Demolition Terminator“. Verfasst von der verhaltensauffälligen Freundin des schüchternen Protagonisten, bringt es dort im allerschönsten unter den Running Gags dieser grellen Komödie einen Leser nach dem anderen dazu, sich vor Entsetzen lautstark zu übergeben. Mit seinem vierten Film „Cyborg She“ schloss Kwak dann sieben Jahre später einen Kreis, indem er seine Variation auf die zitierte Vorlage inszenierte und damit demonstrierte, wie „The Terminator“ hätte aussehen können, hätte James Cameron ihn als romantische Komödie konzipiert.
Bereits in Kwak Jae-Youngs Kinodebüt „My Sassy Girl“ (2001), zur Hochphase der koreanischen New Wave um die Jahrtausendwende entstanden und seither zum viel geliebten Klassiker avanciert, gibt es ein Filmdrehbuch mit dem Titel „Demolition Terminator“. Verfasst von der verhaltensauffälligen Freundin des schüchternen Protagonisten, bringt es dort im allerschönsten unter den Running Gags dieser grellen Komödie einen Leser nach dem anderen dazu, sich vor Entsetzen lautstark zu übergeben. Mit seinem vierten Film „Cyborg She“ schloss Kwak dann sieben Jahre später einen Kreis, indem er seine Variation auf die zitierte Vorlage inszenierte und damit demonstrierte, wie „The Terminator“ hätte aussehen können, hätte James Cameron ihn als romantische Komödie konzipiert.

