In den 1980er Jahren war Patrick Swayze für einen kurzen Moment ein Kinostar. Nach seinem Debüt auf der großen Leinwand im Kreise des durch Francis Ford Coppolas „The Outsiders“ formierten Brat Pack und dem legendären Desaster als faschistoider Pfadfinder in John Milius’ spektakulär gescheiterter Kalter-Krieg-Satire „Red Dawn“ war Swayze im Jahr 1987 plötzlich der Posterboy No. 1 des Weltkinos. „Dirty Dancing“ war einer der unglaublichsten Kassenhits der Dekade, und sein Hauptdarsteller plötzlich Schwarm aller Backfische zwischen 12 und 52 und Mittelpunkt einer der irritierendsten Camp-Phantasmagorien der Kinogeschichte. Gleichwohl schien Swayze selbst ein wenig erschrocken über den Erfolg des trashig-nostalgischen Musicals und setzte in den folgenden Jahren in seiner Rollenauswahl (recht erfolglos) alles daran, eine überbetonte Maskulinität ins Zentrum des Gezeigten zu rücken.
Der Maschine abgerungen
Sam Peckinpah war ein seltsamer Filmemacher. In seiner Bedeutung für das Kino von den 1960er Jahren bis heute kaum zu überschätzen, war er nicht nur ein formaler Innovator des Bewegungskinos, dessen einst revolutionäre Zeitlupenästhetik sich von der tänzerischen Melodramatik eines John Woo bis zu den stilisierten bullet times der Wachowski Brothers in die cineastische Grammatik eingeprägt hat. Er stand und steht bis heute auch für eine äußerst aufschlussreiche Schizophrenie des amerikanischen Kinos, eine Zerrissenheit und ein rastloses Oszillieren zwischen rau-derbem Machismo nebst hypermaskulinen Ritualen und einem ganz eigentümlichen, sensiblen Lyrizismus – so zurückhaltend und sanft, dass man ihn in einem Blinzeln des Auges schon übersehen könnte. Wohl auch deswegen wurde Peckinpah auch zu einem der am häufigsten unverstandenen Filmemacher des amerikanischen Kinos, seine Karriere ein zäher Kampf um jeden Film, mal triumphal gewonnen, häufiger tragisch gescheitert. Jeder Moment von Poesie der Maschine abgerungen.
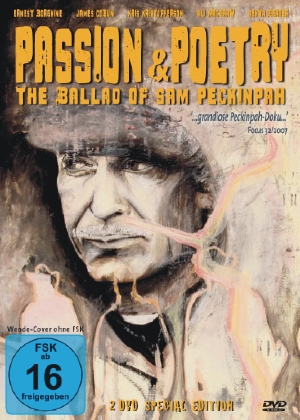 Sam Peckinpah war ein brillanter Filmemacher. In seiner nur 22 Jahre währenden Karriere konnte er dem anfangs noch starren, kunstfeindlichen, dann durch die Auteurs von New Hollywood aufgebrochenen und schließlich wieder neu in Klischees gerinnenden Apparat des amerikanischen Kinos 14 Filme abtrotzen, davon mindestens sechs absolute Meisterwerke. Der ikonische Moment für die Ewigkeit wird wohl immer der blutige Showdown von „The Wild Bunch“ bleiben, und doch, wie typisch für den Filmemacher Peckinpah, birgt selbst dieser unbestreitbare Triumph ein klein wenig Tragik: machte es ihn doch fortan vor allem zu „Bloody Sam“, dem Regisseur, der den Spätwestern zum bis dato ungekannt blutrot von der Leinwand berstenden Massaker fortschrieb. Sicher, Peckinpah war immer auch ein Filmemacher der Gewalt, doch die Ignoranz, die fortan sanfteren Werken wie „The Ballad of Cable Hogue“ oder „Junior Bonner“ zuteil werden sollten, lässt sich sicherlich immer auch ein wenig zum Schock von „The Wild Bunch“ zurückverfolgen. (Auch, wenn dieser natürlich selbst immer schon ausblendet, wie lyrisch, langsam und poetisch „The Wild Bunch“ in Wirklichkeit erzählt ist.)
Sam Peckinpah war ein brillanter Filmemacher. In seiner nur 22 Jahre währenden Karriere konnte er dem anfangs noch starren, kunstfeindlichen, dann durch die Auteurs von New Hollywood aufgebrochenen und schließlich wieder neu in Klischees gerinnenden Apparat des amerikanischen Kinos 14 Filme abtrotzen, davon mindestens sechs absolute Meisterwerke. Der ikonische Moment für die Ewigkeit wird wohl immer der blutige Showdown von „The Wild Bunch“ bleiben, und doch, wie typisch für den Filmemacher Peckinpah, birgt selbst dieser unbestreitbare Triumph ein klein wenig Tragik: machte es ihn doch fortan vor allem zu „Bloody Sam“, dem Regisseur, der den Spätwestern zum bis dato ungekannt blutrot von der Leinwand berstenden Massaker fortschrieb. Sicher, Peckinpah war immer auch ein Filmemacher der Gewalt, doch die Ignoranz, die fortan sanfteren Werken wie „The Ballad of Cable Hogue“ oder „Junior Bonner“ zuteil werden sollten, lässt sich sicherlich immer auch ein wenig zum Schock von „The Wild Bunch“ zurückverfolgen. (Auch, wenn dieser natürlich selbst immer schon ausblendet, wie lyrisch, langsam und poetisch „The Wild Bunch“ in Wirklichkeit erzählt ist.)
Sam Peckinpah war ein schwieriger Filmemacher. Eines jener Genies, die mit Nachdruck absolute Freiheit zur Umsetzung ihrer künstlerischen Visionen verlangten und doch des Apparates vielleicht auch dringend bedurften, gegen den sie so wuterfüllt ankämpften. Kaum einer seiner Filme kam ohne Skandale, Streitereien und Machtkämpfe zustande, die allzu oft die an poetischem Ausdruck wenig interessierten Studioschergen gewannen. Bereits Peckinpahs dritter Film, nach dem zuerst in Double Features verheizten, dann zum Arthouse-Erfolg avancierten ersten großen Werk „Ride the High Country“, geriet ihm zum persönlichen und künstlerischen Desaster, von dem er sich wohl niemals so ganz erholte: „Major Dundee“, gegen größte studiopolitische Widerstände halbwegs zu Ende abgedreht, wurde ihm, teils wohl aus rein böswilliger Schikane, vom Studio in der Postproduktion aus der Hand genommen und zu einem lächerlichen Torso verstümmelt. Ein Schicksal, das in der Folge auch die Meisterwerke „The Wild Bunch“ und „Pat Garrett and Billy the Kid“ traf, und das teilweise erst mehrere Jahrzehnte später in aufwendigen Restaurationen zumindest gemildert werden konnte – wenn überhaupt; stellt doch auch die inzwischen auf DVD verfügbare „Extended Edition“ von „Major Dundee“ noch immer einen auf tragische Weise unvollendeten Film dar.
 Sam Peckinpah war ein faszinierender Filmemacher. Und wohl, weil er all das auf einmal war, hat sich der 1967 geborene Deutsche Mike Siegel entschlossen, zu einem der bedeutendsten Peckinpah-Biographen und Gralshüter seines Werkes zu werden. Die Cinephilen des deutschsprachigen Raumes profitierten von der Leidenschaft des Autoren, Filmemachers und Festivalmachers schon vielfach, etwa durch die wesentlich durch seine Initiative entstandene DVD-Edition zu „Straw Dogs“, die den hierzulande zuvor nur gekürzt und überhaupt in unwürdiger Form publizierten Klassiker endlich angemessen präsentierte und kontextualisierte, oder auch durch den wunderbaren Fotoband „Passion & Poetry: Sam Peckinpah in Pictures“. Unter dem gleichen Titel „Passion & Poetry“ veröffentlicht Siegel nun, vier Jahre nach der Fertigstellung und der Premiere auf dem Münchner Filmfest, auch seine große Dokumentation und Hommage an seinen Heroen. „The Ballad of Sam Peckinpah“, das trifft den Tonfall des Filmes schon sehr genau: Es geht hier eindeutig und niemals verschleiert um Heldenverehrung, weniger um eine kritische oder analytische Auseinandersetzung mit dem Werk Peckinpahs. Der Schwerpunkt Siegels liegt dabei auf Interviews mit den Weggefährten des Filmemachers, der im Verlauf seiner Karriere eine eingeschworene Truppe von Mitarbeitern um sich versammelte. Mit James Coburn, Kris Kristofferson, Ernest Borgnine, Senta Berger, Mario Adorf, David Warner, Bo Hopkins undundund versammelt sich hier tatsächlich eine eindrucksvolle Riege schauspielerischen Potenzials vor Siegels Kamera, um ihre persönlichen Erinnerungen an Peckinpah zu teilen. Ergänzt werden ihre Statements mit kurzen Filmausschnitten, die allerdings nahezu vollständig den Trailern der jeweiligen Filme entnommen sind – hier schlägt die unabhängige Produktionsgeschichte von „Passion & Poetry“ zu Buche, denn die Rechte für ausführlichere Filmausschnitte waren wohl schlicht nicht bezahlbar. Doch was auch zum großen Manko hätte werden könnte, das deutet Siegel zur bedeutendsten Stärke seines Filmes um. „Passion & Poetry“ erzählt in erster Linie vom Menschen Sam Peckinpah, den er in der Kombination von bei Dreharbeiten entstandenen behind the scenes-Filmaufnahmen, Statements aus Interviews und eben unzähligen Anekdoten und Reminiszenzen lebendig werden lässt. Als Ergänzung zur ohnehin für jeden Cinephilen unerlässlichen Begegnung mit dem Gesamtwerk Peckinpahs funktioniert „Passion & Poetry“ somit tatsächlich ganz wunderbar und stellt letzten Endes vielleicht auch jenes Vermächtnis dar, das Peckinpah mit seinem letzten Film, dem eher drögen (und hier auffälligerweise gleich nahezu völlig übergangenen) Verschwörungsthriller „The Osterman Weekend“, eher verwehrt blieb.
Sam Peckinpah war ein faszinierender Filmemacher. Und wohl, weil er all das auf einmal war, hat sich der 1967 geborene Deutsche Mike Siegel entschlossen, zu einem der bedeutendsten Peckinpah-Biographen und Gralshüter seines Werkes zu werden. Die Cinephilen des deutschsprachigen Raumes profitierten von der Leidenschaft des Autoren, Filmemachers und Festivalmachers schon vielfach, etwa durch die wesentlich durch seine Initiative entstandene DVD-Edition zu „Straw Dogs“, die den hierzulande zuvor nur gekürzt und überhaupt in unwürdiger Form publizierten Klassiker endlich angemessen präsentierte und kontextualisierte, oder auch durch den wunderbaren Fotoband „Passion & Poetry: Sam Peckinpah in Pictures“. Unter dem gleichen Titel „Passion & Poetry“ veröffentlicht Siegel nun, vier Jahre nach der Fertigstellung und der Premiere auf dem Münchner Filmfest, auch seine große Dokumentation und Hommage an seinen Heroen. „The Ballad of Sam Peckinpah“, das trifft den Tonfall des Filmes schon sehr genau: Es geht hier eindeutig und niemals verschleiert um Heldenverehrung, weniger um eine kritische oder analytische Auseinandersetzung mit dem Werk Peckinpahs. Der Schwerpunkt Siegels liegt dabei auf Interviews mit den Weggefährten des Filmemachers, der im Verlauf seiner Karriere eine eingeschworene Truppe von Mitarbeitern um sich versammelte. Mit James Coburn, Kris Kristofferson, Ernest Borgnine, Senta Berger, Mario Adorf, David Warner, Bo Hopkins undundund versammelt sich hier tatsächlich eine eindrucksvolle Riege schauspielerischen Potenzials vor Siegels Kamera, um ihre persönlichen Erinnerungen an Peckinpah zu teilen. Ergänzt werden ihre Statements mit kurzen Filmausschnitten, die allerdings nahezu vollständig den Trailern der jeweiligen Filme entnommen sind – hier schlägt die unabhängige Produktionsgeschichte von „Passion & Poetry“ zu Buche, denn die Rechte für ausführlichere Filmausschnitte waren wohl schlicht nicht bezahlbar. Doch was auch zum großen Manko hätte werden könnte, das deutet Siegel zur bedeutendsten Stärke seines Filmes um. „Passion & Poetry“ erzählt in erster Linie vom Menschen Sam Peckinpah, den er in der Kombination von bei Dreharbeiten entstandenen behind the scenes-Filmaufnahmen, Statements aus Interviews und eben unzähligen Anekdoten und Reminiszenzen lebendig werden lässt. Als Ergänzung zur ohnehin für jeden Cinephilen unerlässlichen Begegnung mit dem Gesamtwerk Peckinpahs funktioniert „Passion & Poetry“ somit tatsächlich ganz wunderbar und stellt letzten Endes vielleicht auch jenes Vermächtnis dar, das Peckinpah mit seinem letzten Film, dem eher drögen (und hier auffälligerweise gleich nahezu völlig übergangenen) Verschwörungsthriller „The Osterman Weekend“, eher verwehrt blieb.
Passion & Poetry: The Ballad of Sam Peckinpah
(Deutschland 2005, Mike Siegel)
Regie, Buch, Schnitt: Mike Siegel; Musik: Gitanes Blondes, Kris Kristofferson; Kamera: Mike Siegel, Kara Stephens
Darsteller: Ernest Borgnine, James Coburn, Bo Hopkins, Senta Berger, Mario Adorf, David Warner, L.Q. Jones, R.G. Armstrong, Kris Kristofferson, Ali MacGraw, Lupita Peckinpah u.a.
Länge: 115 Min.
Verleih:El Dorado
Zur DVD von El Dorado
Die ohne großen Vertrieb im Rücken aus dem Boden gestampfte DVD-Edition ist schlichtweg beeindruckend. Auf der ersten DVD befindet sich neben dem Hauptfilm im englischen Originalton mit optionalen deutschen Untertiteln noch ein Audiokommentar von Mike Siegel, und auf der Bonus-DVD gibt es dann mit dem in drei Teile gesplitteten „Stories on a Storyteller“ gleich einen kompletten weiteren Dokumentarfilm mit mehr Interviews, mehr Anekdoten, mehr Informationen. Dieser belegt eindrucksvoll, dass „Passion & Poetry“ wohl auch locker doppelt so lang hätte ausfallen können. Weiterhin gibt es eine Featurette über die Drehorte von „The Wild Bunch“, ein 15-minütiges Interview mit Ernest Borgnine und eine Featurette über Mike Siegels Arbeit als Gralshüter Peckinpahs für Festivals, Retrospektiven oder Ausstellungen. Insgesamt eine fantastische DVD-Edition, die von wahrer Hingabe zeugt.
Bild: 1,78:1
Ton: Englisch (Dolby Digital 2.0)
Untertitel: Deutsch
Extras: Audiokommentar von Mike Siegel, Stories on a Storyteller (Teil 1: The Westerner, Teil 2: Art & Success, Teil 3: Poet on the Loose), Mapache Territory, Ernie on „The Wild Bunch“, Mike’s Home Movies
FSK: ab 12 Jahren
Basterd Pop und Tarantismus
Quentin Tarantinos neuer Film „Inglourious Basterds“ hat die deutsche Diskursmaschinerie angeworfen, so viel ist klar. Die amerikanisch-deutsche, unter massig Medienrummel in Babelsberg inszenierte Koproduktion zählte sicherlich von vornherein zu den heiß erwarteten Filmen dieses an Blockbustern nicht unbedingt armen Kinosommers. Die Gralshüter der Political Correctness konnten es kaum erwarten, sich über die Unverschämtheit von „Inglourious Basterds“ aufzuregen, der die historischen Fakten hemmungslos zurechtbiegt und zu einer jüdischen Rachefantasie umschmiedet. Die rechtsnationale Szene hingegen fühlt sich erwartetermaßen in ihrer deutschtümelnden Soldatenehre verletzt und startete rechtzeitig zum Start, insbesondere in der Online-Berichterstattung, groß angelegte Hetzkampagnen. Und auch so manchem unbedarfteren Zuschauer scheint es zweifelhaft, ob man und insbesondere der verspielte Postmodernist Tarantino sich denn soviel Freiheit im Umgang mit den historischen Fakten erlauben dürfte. Andere wiederum empfinden und preisen eine befreiende Wirkung, eine Erlösung von der Last der historischen Schuld und neu erschlossene Genehmigung, die eigene Vergangenheit nun künftig spielerisch als popkulturelle Actionerzählung zu be- und verhandeln. Right for the wrong reasons.
 Dass es sich nämlich so einfach nicht verhält mit Tarantinos neuem Film, das legt Georg Seeßlen in einer beeindruckend schnell nach der Premiere verfassten, verlegten und rechtzeitig zum Kinostart auf den Markt gebrachten Buchveröffentlichung dar. „Quentin Tarantino gegen die Nazis“, so der treffende Titel des Bändchens, das darüber hinaus noch „Alles über Inglourious Basterds“ zu verraten verspricht. Um diesem Ziel zumindest nahe zu kommen, nähert sich Seeßlen seinem Gegenstand gleich von mehreren verschiedenen Seiten an. In einem ersten Teil legt er dar, was den speziellen postmodernen Collagestil des Kinos von Quentin Tarantino ausmacht, und denkt dies bereits unter dem Vorzeichen und mit dem Aspekt der Bastardisierung zusammen. Eine kleine Kulturgeschichte des Bastards steht am Anfang, auf die eine knappe Einführung in den „Tarantismus“ folgt – falls es wirklich noch jemanden geben sollte, der die vier großen Filme des Quentin Tarantino noch nicht in- und auswendig kennen sollte. („Kill Bill“ soll hier als ein Film gelten, und über die Kooperation des begabten Geeks Tarantino mit dem unbegabten Geek Robert Rodriguez zum unheiligen „Grindhouse“-Projekt sei hier gnädig der Mantel des Schweigens gedeckt.) In einem ausführlichen zweiten Teil zeichnet Seeßlen dann ausführlich den Plot von „Inglourious Basterds“ nach, nebst einer Reihe von typografisch markierten Exkursen zu Passagen des bereits weit vor der Veröffentlichung im Internet verfügbaren Drehbuch, die es nicht in den fertigen Film geschafft haben. In diesen Abschweifungen und Umwegen, vereinzelten Geistesblitzen, liegt natürlich wie immer die eigentliche Stärke der Texte von Georg Seeßlen. Immer wieder entfernt er sich scheinbar vom Stoff, nur um dann von anderer, meist sehr aufschlussreicher Seite wieder zum Gegenstand seiner Überlegungen zurückzukehren. Das ist nicht unbedingt immer streng wissenschaftlich, aber „Quentin Tarantino gegen die Nazis“ ist auch kein akademisches Buch. Es ist aber auch kein Fanbuch, das aus wahlweise cinephiler oder rein nerdiger Perspektive seinem Gegenstand huldigt. Es ist vielmehr eine Gedankensammlung, ein Angebot unterschiedlicher Herangehensweisen an einen Film, der nicht nur großes Kino sein will und erst recht nicht nur schnödes Unterhaltungsprodukt – auch wenn er beides im Übermaß ist –, sondern der sehr bewusst und reflektiert mit Erwartungshaltungen unterschiedlichster Seiten bricht, andere übererfüllt, und der letztendlich zu den herausfordernden wie herausragenden Filmen dieses Kinojahres gehören.
Dass es sich nämlich so einfach nicht verhält mit Tarantinos neuem Film, das legt Georg Seeßlen in einer beeindruckend schnell nach der Premiere verfassten, verlegten und rechtzeitig zum Kinostart auf den Markt gebrachten Buchveröffentlichung dar. „Quentin Tarantino gegen die Nazis“, so der treffende Titel des Bändchens, das darüber hinaus noch „Alles über Inglourious Basterds“ zu verraten verspricht. Um diesem Ziel zumindest nahe zu kommen, nähert sich Seeßlen seinem Gegenstand gleich von mehreren verschiedenen Seiten an. In einem ersten Teil legt er dar, was den speziellen postmodernen Collagestil des Kinos von Quentin Tarantino ausmacht, und denkt dies bereits unter dem Vorzeichen und mit dem Aspekt der Bastardisierung zusammen. Eine kleine Kulturgeschichte des Bastards steht am Anfang, auf die eine knappe Einführung in den „Tarantismus“ folgt – falls es wirklich noch jemanden geben sollte, der die vier großen Filme des Quentin Tarantino noch nicht in- und auswendig kennen sollte. („Kill Bill“ soll hier als ein Film gelten, und über die Kooperation des begabten Geeks Tarantino mit dem unbegabten Geek Robert Rodriguez zum unheiligen „Grindhouse“-Projekt sei hier gnädig der Mantel des Schweigens gedeckt.) In einem ausführlichen zweiten Teil zeichnet Seeßlen dann ausführlich den Plot von „Inglourious Basterds“ nach, nebst einer Reihe von typografisch markierten Exkursen zu Passagen des bereits weit vor der Veröffentlichung im Internet verfügbaren Drehbuch, die es nicht in den fertigen Film geschafft haben. In diesen Abschweifungen und Umwegen, vereinzelten Geistesblitzen, liegt natürlich wie immer die eigentliche Stärke der Texte von Georg Seeßlen. Immer wieder entfernt er sich scheinbar vom Stoff, nur um dann von anderer, meist sehr aufschlussreicher Seite wieder zum Gegenstand seiner Überlegungen zurückzukehren. Das ist nicht unbedingt immer streng wissenschaftlich, aber „Quentin Tarantino gegen die Nazis“ ist auch kein akademisches Buch. Es ist aber auch kein Fanbuch, das aus wahlweise cinephiler oder rein nerdiger Perspektive seinem Gegenstand huldigt. Es ist vielmehr eine Gedankensammlung, ein Angebot unterschiedlicher Herangehensweisen an einen Film, der nicht nur großes Kino sein will und erst recht nicht nur schnödes Unterhaltungsprodukt – auch wenn er beides im Übermaß ist –, sondern der sehr bewusst und reflektiert mit Erwartungshaltungen unterschiedlichster Seiten bricht, andere übererfüllt, und der letztendlich zu den herausfordernden wie herausragenden Filmen dieses Kinojahres gehören.
Seeßlen selbst schreibt, es handle sich bei „Inglourious Basterds“ um einen Film, „an dem sich das, was Geschichte, Erinnerung, Erzählung und Kino ist, neu definieren muss.“ Jedenfalls ist es ein Film, der von vielleicht überraschender, jedenfalls aber profunder Tiefe ist, von grundlegender Ambivalenz und von nachhaltiger Wirkung. Georg Seeßlens Buch erklärt nicht „Alles über Inglourious Basterds“, kann und will das auch nicht – und dass sich der Autor darüber bewusst ist, macht eine große Stärke seines Schreibens aus. „Quentin Tarantino gegen die Nazis“ ist eher ein Gesprächsangebot, eine Fundgrube kluger Gedanken zu einem Film, dessen wahre Bedeutung erst noch ausgefochten werden muss. Es wird sich, so ist zu vermuten, ein langwieriger und kontroverser Diskurs um ihn entwickeln. Als Auftakt zu diesem Diskurs wird Seeßlens Buch unverzichtbar sein.
Georg Seeßlen
Quentin Tarantino gegen die Nazis. Alles über „Inglourious Basterds“
Berlin: Bertz + Fischer 2009
176 Seiten, 9,90 Euro
Uncanny Planet
James Camerons 3D-Epos „Avatar“ ist der Film dieses Kinojahres, der die Spekulationen des vorfreudigen Publikums am heftigsten anheizt. Soviel ist bereits knapp vier Monate vor dem weltweiten Starttermin klar. Es wird sich bei „Avatar“ um Camerons ersten langen Spielfilm seit zwölf Jahren handeln – und somit um den Film, der auf „Titanic“, den erfolgreichsten Film der Kinogeschichte, folgt. Und um den Film, für den Cameron über den Zeitraum von insgesamt 14 Jahren erst eine ganz neue 3D-Technologie entwickeln musste. Nun ist sie ja seit einigen Monaten auch zunehmend präsenter in deutschen Kinosälen, die beeindruckende digitale RealD-Technologie, ist jüngst mit der Platzierung von Pixars »Up!« als Eröffnungsfilm des Filmfestivals von Cannes auch zu höheren cineastischen Weihen befördert worden – und doch scheint noch niemand so recht zu wissen, was nun davon zu halten ist. Das Spektrum der Meinungsäußerungen reicht von der »Zukunft des Kinos« (Jeffrey Katzenberg) bis zur Auffassung, es handle sich hierbei lediglich um ein Gimmick, eine vorübergehende Modeerscheinung. Tatsächlich stellt die neue 3D-Technologie zunächst einmal eine bedeutende Erweiterung der Möglichkeiten der Kinosprache dar – was freilich künftig damit geschieht, ob das Potenzial verwirklicht oder verwirkt wird, das scheint momentan auch und vor allem an Camerons „Avatar“ verhandelt zu werden. Wird dieser eine Film künstlerisch und kommerziell zum erwarteten Erfolg, dann scheinen die Möglichkeiten für künftige, ambitionierte 3D-Filme unbegrenzt. Enttäuscht er auf einer der beiden Seiten der Medaille, könnte die Seifenblase einen neuen Alleinstellungsmerkmals des Kinos gegenüber dem Heimkino schneller platzen, als es Hollywood lieb sein dürfte.
![]() Der 21. August 2009 wurde nun, nachdem der Hype um „Avatar“ lang durch die strenge Nichtherausgabe von Bildmaterial angeheizt wurde, zum weltweiten „Avatar Day“ erklärt: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des ersten (zweidimensionalen) Teasers in den Weiten des Internet wurde einer begrenzten Zahl glücklicher Zuschauer die Möglichkeit gegeben, in 3D-fähigen Kinos eine ca. 20minütige Auswahl von Sequenzen aus der ersten Hälfte von „Avatar“ zu sehen – dreidimensional, und somit erstmals wirklich etwas aus dem Film zu sehen. Das Wichtigste vorab: Ja, die Welt, die Cameron für „Avatar“ hat programmieren lassen, ist wunderschön. Der Großteil der im Showcase gezeigten Sequenzen spielt in einem Dschungel, in dem die Helden auf allerlei farbenfrohes, meist feindlich gesinntes, Fabelgetier treffen. Diese fremde Vegetation erscheint plastisch und ästhetisch eindrucksvoll komponiert. Einen Kontrastpunkt hierzu setzen leider die Character Animations, die durch eine Motion-Capture-Technik auf dem derzeitigen state of the art vorgenommen wurden. Diese erinnern durchaus noch an die wenig überzeugenden Versuche der jüngeren Robert-Zemeckis-Filme „The Polar Express“ oder „Beowulf“ und haben es somit noch immer nicht geschafft, dem Uncanny Valley zu entrinnen.
Der 21. August 2009 wurde nun, nachdem der Hype um „Avatar“ lang durch die strenge Nichtherausgabe von Bildmaterial angeheizt wurde, zum weltweiten „Avatar Day“ erklärt: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des ersten (zweidimensionalen) Teasers in den Weiten des Internet wurde einer begrenzten Zahl glücklicher Zuschauer die Möglichkeit gegeben, in 3D-fähigen Kinos eine ca. 20minütige Auswahl von Sequenzen aus der ersten Hälfte von „Avatar“ zu sehen – dreidimensional, und somit erstmals wirklich etwas aus dem Film zu sehen. Das Wichtigste vorab: Ja, die Welt, die Cameron für „Avatar“ hat programmieren lassen, ist wunderschön. Der Großteil der im Showcase gezeigten Sequenzen spielt in einem Dschungel, in dem die Helden auf allerlei farbenfrohes, meist feindlich gesinntes, Fabelgetier treffen. Diese fremde Vegetation erscheint plastisch und ästhetisch eindrucksvoll komponiert. Einen Kontrastpunkt hierzu setzen leider die Character Animations, die durch eine Motion-Capture-Technik auf dem derzeitigen state of the art vorgenommen wurden. Diese erinnern durchaus noch an die wenig überzeugenden Versuche der jüngeren Robert-Zemeckis-Filme „The Polar Express“ oder „Beowulf“ und haben es somit noch immer nicht geschafft, dem Uncanny Valley zu entrinnen.
Zum Tonfall der gezeigten Ausschnitte ist zu sagen, dass noch nicht viel zu sagen ist. Wie alle Filme von James Cameron enthalten diese Sequenzen Ideen, die ein großes Potenzial bergen. Cameron ist ja keineswegs ein dummer Filmemacher. An anderen Stellen treten mit Sentiment und Humor an der Grenze zum Klamauk weitere verlässliche Kennzeichen von Camerons Stil zutage. Zum Plot ist beim besten Willen noch nicht einmal zu mutmaßen, nach der Ansicht von 20 Minuten von kolportierten 200 des finalen Films. Letztlich ist festzuhalten, dass „Avatar“ ohnehin von vornherein einer der Filme war, die man sich in diesem Jahr würde anschauen müssen. Nun kann man sich auch noch darauf freuen – denn zumindest der Verfasser dieser Zeilen hätte nach dem Ende der 20 Minuten gern noch weitere drei Stunden in dieser fremden Welt verbracht.
Operation: Kino
Quentin Tarantino schien am Ende zu sein, streng genommen schon nach „Jackie Brown“, seinem bis heute besten und reifsten Film. Gut, „Kill Bill“ war ein monumentales, überwältigendes, stilistisch brillantes Spektakel, aber auch eine Rekapitulation jener Entwicklung, die Tarantino in seinen ersten drei Filmen durchgemacht hat. „Reservoir Dogs“: perfekt entwickeltes Genrekino. „Pulp Fiction“: die selbstreflexive Arbeit über das Genrekino. „Jackie Brown“: die melancholische Meditation nach dem Genrekino. Und dann eben „Kill Bill“: alles noch einmal, im schnellen Vorlauf. Nur um dann wieder im Genrekino anzukommen, mit all dem selbstreflexiven Ballast im Hinterkopf und somit intellektuell legitimiert.
Ein analoger Superheld für eine digitale Welt
„Isaac“ – Intuitives synthetisches autonomes Angriffs-Commando. Und, wie uns der deutsche Untertitel glauben machen möchte: „Die finale Waffe“. Tatsächlich ist Isaac (Rich Franklin) das Ergebnis eines streng geheimen Rüstungsprogramms der Regierung, das zum Tode verurteilte Mörder zu perfekten Kampfmaschinen für den militärischen Einsatz umbauen will. John Steads Film „Cyborg Soldier“ setzt ein mit der Flucht Isaacs aus jenem Labor, in dem er zur Menschmaschine aufgerüstet und zum Töten umprogrammiert wurde, und folgt ihm auf seiner Flucht vor dem Killerkommando des skrupellosen Dr. Hart (Bruce Greenwood). Der Zufall führt ihn dabei mit der Polizistin Lindsey Reardon (Tiffani Thiessen) zusammen, die eher unbedarft zwischen die Fronten dieses Konfliktes gerät. Im Verlauf der Flucht kehrt die Erinnerung Isaacs an sein früheres Leben langsam zurück, und die finsteren Machenschaften Harts decken sich allmählich auf bis hin zur abschließenden Konfrontation, die sich persönlicher als erwartet gestaltet…
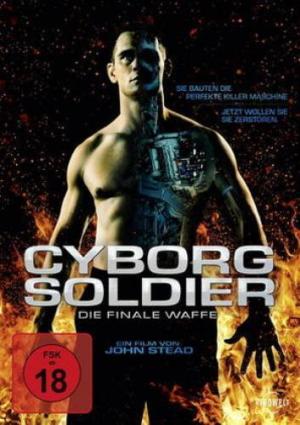 In der Gestalt des Maschinenmenschen manifestierten sich von jeher Sehnsüchte und Problematiken des Aktionskinos. Einerseits galt sie der Science Fiction in schöner Regelmäßigkeit als Spiegel, in dem die verlorenen Menschen ihrer dystopischen Welten ihre längst abhandene Menschlichkeit wiederfanden. Andererseits wird sie zur strukturellen Metapher, die den grundlegenden Zwiespalt des Actionfilms beschreibt, der stets aufs Neue zwischen technokratischer Maschinisierung und dem nachgerade neurotischen Zwang zum Herunterbrechen des überlebensgroßen Geschehens auf menschliches Maß zerrissen zu werden droht. Im Gegensatz zum offenkundig Maschinellen des Roboters und dem antropomorphen Androiden jedoch ist der Cyborg stets beides: gewesener Mensch, an den Spuren des Humanismus sich wider die eigene Programmierung und die Außenwahrnehmung festklammernd, und Maschine, posthumane, mit übermenschlichen Begabungen ausgestattete Existenzform. Hybridwesen, in keiner Welt wirklich zuhause, ewigem Zweifel um die eigene Ontologie ausgeliefert – vom melancholischen „Blade Runner“ Rick Deckard, der seine eigene Menschlichkeit als artifiziell akzeptieren muss, über Paul Verhoevens „RoboCop“ bis hin zu Marcus Wright in McGs fabelhaftem „Terminator Salvation“ oder zur verwirrt-traurigen Young-Goon in Park Chan-Wooks „I’m a Cyborg But That’s OK“, die ihre Menschlichkeit abzuwerfen sucht und sich folgerichtig in einen grellen Science-Fiction-Traum hineinphantasiert.
In der Gestalt des Maschinenmenschen manifestierten sich von jeher Sehnsüchte und Problematiken des Aktionskinos. Einerseits galt sie der Science Fiction in schöner Regelmäßigkeit als Spiegel, in dem die verlorenen Menschen ihrer dystopischen Welten ihre längst abhandene Menschlichkeit wiederfanden. Andererseits wird sie zur strukturellen Metapher, die den grundlegenden Zwiespalt des Actionfilms beschreibt, der stets aufs Neue zwischen technokratischer Maschinisierung und dem nachgerade neurotischen Zwang zum Herunterbrechen des überlebensgroßen Geschehens auf menschliches Maß zerrissen zu werden droht. Im Gegensatz zum offenkundig Maschinellen des Roboters und dem antropomorphen Androiden jedoch ist der Cyborg stets beides: gewesener Mensch, an den Spuren des Humanismus sich wider die eigene Programmierung und die Außenwahrnehmung festklammernd, und Maschine, posthumane, mit übermenschlichen Begabungen ausgestattete Existenzform. Hybridwesen, in keiner Welt wirklich zuhause, ewigem Zweifel um die eigene Ontologie ausgeliefert – vom melancholischen „Blade Runner“ Rick Deckard, der seine eigene Menschlichkeit als artifiziell akzeptieren muss, über Paul Verhoevens „RoboCop“ bis hin zu Marcus Wright in McGs fabelhaftem „Terminator Salvation“ oder zur verwirrt-traurigen Young-Goon in Park Chan-Wooks „I’m a Cyborg But That’s OK“, die ihre Menschlichkeit abzuwerfen sucht und sich folgerichtig in einen grellen Science-Fiction-Traum hineinphantasiert.
Als perfekte Waffensysteme werden die Cyborgs des Science-Fiction-Kinos fürgewöhnlich konzipiert – und vielleicht ist Isaac aus „Cyborg Soldier“ im Grunde wirklich die perfekte Waffe. Das hieße hier: die menschlichste Waffe, insofern er sich in Testreihen als des Tötens unfähig erweist, sofern er keiner Attacke ausgesetzt ist. Eine Waffe für ein Zeitalter strikter Verteidigungskriege also, eine pazifistische Waffe. Würde ein Waffensystem nach dem Modell von Isaac folglich zum Einsatz kommen, so würde dies nicht nur den Schutz gegen potentielle Angreifer bedeuten, sondern auch eine Absicherung gegen kriegerische Übergriffe aus den eigenen Reihen bedeuten. Eine kontextabhängige Waffe, die nur noch auf die eigene Bedrohung reagieren könnte und der grenzen- und übergesetzlichen Machtausübung des Stärkeren einen Riegel vorschieben würde, somit die eigene Militärpolitik nachhaltig prägen würde. Schlussendlich ist es auch in „Cyborg Soldier“ der Befehl, Unschuldige zu töten, der Isaac dazu bringt, aus seinem Gefängnis und seiner vorgesehenen Rolle als Killermaschine auszubrechen und sich auf die Suche nach seiner gelöschten Erinnerung und vergessenen Menschlichkeit zu machen. Und einmal mehr ist es am Ende der Maschinenmensch, der im Selbstopfer ein korruptes System zerstört und sich spätestens im eigenen Vergehen als letzter wahrer Kämpfer für das Menschliche in einer von instrumenteller Vernunft geprägten Welt erweist.
John Steads Film überrascht vielleicht vor allem durch seine Seriosität: Mit einfachsten Mitteln und kleinem Budget inszeniert, hält er sich doch über weite Strecken in weiter Distanz vom Trashterrain des Gros der Cyborg-Actioner der 1980er und 1990er Jahre, mit denen das B-Kino auf den großen Erfolg von James Camerons zwei „Terminator“-Filmen reagierte. Stattdessen gibt sich „Cyborg Soldier“ als geradezu klassisch entwickeltes Science-Fiction-Kino, irgendwo zwischen „RoboCop“ und John Carpenters „Starman“. Angenehm ernsthaft und meisterhaft verdichtet, findet er eine ganze Reihe großartiger Bilder einerseits in den verschneiten Wäldern Kanadas, andererseits in den klaustrophobischen Fluren des geheimen Laborsystems. Großes Kino im kleinen Format.
Cyborg Soldier
(USA 2008)
Regie: John Stead; Buch: John Stead, John Flock, Christopher Warre Smets; Musik: Ryan Latham; Kamera: David Mitchell; Schnitt: Mark Sanders
Darsteller: Rich Franklin, Bruce Greenwood, Tiffani Thiessen, Aaron Abrams, Wendy Anderson, Steve Lucescu, Simon Northwood, Kevin Rushton, Brian Frank u.a.
Länge: 85 Min.
Verleih: Kinowelt
Zur DVD von Kinowelt
Die Bild- und Tonqualität der Kinowelt-DVD sind hervorragend. Als Bonusmaterial ist immerhin ein 15-minütiges Making-of enthalten sowie 2 Trailer und eine Fotogalerie.
Bild: 1,78:1
Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Stereo), Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Making-of, Trailer, Fotogalerie
FSK: Keine Jugendfreigabe
The Making and Unmaking of Jean-Claude Van Damme
JCVD – ein Filmtitel, wie er luzider kaum sein könnte. JCVD, das ist Jean-Claude Van Damme, und im Grunde ist das bereits das Wesentliche, was man über einen Film mit Jean-Claude Van Damme wissen muss. „JCVD“ ist nicht einfach nur ein Film mit Jean-Claude Van Damme, aber dazu später mehr.
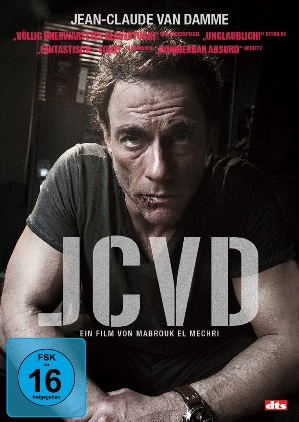 Vor einer Annäherung an Mabrouk El Mechris Film müsste ein Nachdenken über die Karriere und den Rollentypus des Jean-Claude Van Damme stehen, denn letztlich entschlüsselt sich wesentlich vor dessen Hintergrund das Oeuvre des Belgiers, und dann vor allem auch „JCVD“. Van Damme, das war im Grunde immer einer der Guten, auch wenn das meist keiner so richtig gemerkt hat. Vielleicht war es vor allem der Zeitgeist, der an ihm vorüber gezogen war – auch, wenn er ihn zunächst in den Himmel zu tragen schien. Der Durchbruch gelang dem belgischen Karatemeister 1986 mit einer Schurkenrolle in der US-asiatischen Coproduktion „No Retreat, No Surrender“, die hierzulande unter dem Titel „Karate Tiger“ eine schier endlose Filmreihe begründete, deren einzelne Beiträge meist rein gar nichts miteinander zu tun hatten. 1986, das war das Jahr, in dem die Überikonen des Actionkinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität befanden und sich mit „Cobra“ einerseits, und „Raw Deal“ andererseits, ein Duell um Publikumsgunst und Box Office lieferten. Das Actionkino war eine Wachstumsbranche, und folgerichtig zog es Kampfsportmeister aus aller Welt vor die Kamera, um in die überlebensgroßen Fußstapfen der Hyperstars zu treten. Eine überaus virile B-Movie-Industrie pumpte einen schnell und günstig produzierten Prügel- & Schießfilm nach dem anderen in einen stets nach mehr verlangenden Markt hinein, und die mal mehr, mal weniger kinematographisch kompatiblen Recken dieser kleinen Filme einte vor allem der Traum, die Nachfolge der allmählich, aber unaufhaltsam alternden Stallone und Schwarzenegger antreten zu können und zum größten Actionhelden des Planeten zu werden. Ihre Stunde schien dann in den späten 80ern und frühen 90ern gekommen: Die Actionikonen sahen sich – vorerst – an den Grenzen ihrer Körperlichkeit angekommen und versuchten sich, mit eher mediokrem Erfolg, an einer zweiten Karriere als Komödiendarsteller. Und im Gegenzug wurden die Produktionen eines Van Damme oder auch Steven Seagal größer, aufwendiger, ambitionierter – der Sprung in die A-Liga schien für einen Moment lang, mit „Universal Soldier“ oder „Timecop“ für Van Damme oder mit „Under Siege“ für Seagal, möglich. Nur dass dann die A-Liga aufhörte zu existieren. Mit der Marginalisierung von Stallone und Schwarzenegger – die dann freilich noch über Jahre verschleppt und erst allmählich sichtbar wurde – starb auch das Kino, für das sie standen, und somit stießen die natürlichen Erben ihrer Rollen an neu gesetzte Grenzen.
Vor einer Annäherung an Mabrouk El Mechris Film müsste ein Nachdenken über die Karriere und den Rollentypus des Jean-Claude Van Damme stehen, denn letztlich entschlüsselt sich wesentlich vor dessen Hintergrund das Oeuvre des Belgiers, und dann vor allem auch „JCVD“. Van Damme, das war im Grunde immer einer der Guten, auch wenn das meist keiner so richtig gemerkt hat. Vielleicht war es vor allem der Zeitgeist, der an ihm vorüber gezogen war – auch, wenn er ihn zunächst in den Himmel zu tragen schien. Der Durchbruch gelang dem belgischen Karatemeister 1986 mit einer Schurkenrolle in der US-asiatischen Coproduktion „No Retreat, No Surrender“, die hierzulande unter dem Titel „Karate Tiger“ eine schier endlose Filmreihe begründete, deren einzelne Beiträge meist rein gar nichts miteinander zu tun hatten. 1986, das war das Jahr, in dem die Überikonen des Actionkinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität befanden und sich mit „Cobra“ einerseits, und „Raw Deal“ andererseits, ein Duell um Publikumsgunst und Box Office lieferten. Das Actionkino war eine Wachstumsbranche, und folgerichtig zog es Kampfsportmeister aus aller Welt vor die Kamera, um in die überlebensgroßen Fußstapfen der Hyperstars zu treten. Eine überaus virile B-Movie-Industrie pumpte einen schnell und günstig produzierten Prügel- & Schießfilm nach dem anderen in einen stets nach mehr verlangenden Markt hinein, und die mal mehr, mal weniger kinematographisch kompatiblen Recken dieser kleinen Filme einte vor allem der Traum, die Nachfolge der allmählich, aber unaufhaltsam alternden Stallone und Schwarzenegger antreten zu können und zum größten Actionhelden des Planeten zu werden. Ihre Stunde schien dann in den späten 80ern und frühen 90ern gekommen: Die Actionikonen sahen sich – vorerst – an den Grenzen ihrer Körperlichkeit angekommen und versuchten sich, mit eher mediokrem Erfolg, an einer zweiten Karriere als Komödiendarsteller. Und im Gegenzug wurden die Produktionen eines Van Damme oder auch Steven Seagal größer, aufwendiger, ambitionierter – der Sprung in die A-Liga schien für einen Moment lang, mit „Universal Soldier“ oder „Timecop“ für Van Damme oder mit „Under Siege“ für Seagal, möglich. Nur dass dann die A-Liga aufhörte zu existieren. Mit der Marginalisierung von Stallone und Schwarzenegger – die dann freilich noch über Jahre verschleppt und erst allmählich sichtbar wurde – starb auch das Kino, für das sie standen, und somit stießen die natürlichen Erben ihrer Rollen an neu gesetzte Grenzen.
 Anders freilich als Steven Seagal, der sich recht bald in sein Schicksal zu ergeben schien und lustlos, resigniert und körperlich verfallend einen unambitionierten Streifen nach dem anderen herunterzukurbeln begann, schien Van Damme eher als tragische Figur greifbar zu werden. In seinem Regiedebüt „The Quest“ oder in Peter MacDonalds „Legionnaire“ versuchte er, im kleinen Maßstab an Hollywoods Tradition des großen, romantischen Abenteuerkinos anzuknüpfen – und lief stets aufs Neue mit dem Kopf gegen die Wand. Mit „Sudden Death“ legte er eine grundsolide Miniatur nach dem klassischen „Die Hard“-Modell vor, mit „Nowhere to Run“ oder „Lionheart“ Versuche eines eher dramatisch begriffenen Aktionskinos. Und dann sind da noch die Arbeiten mit den großen Regisseuren der Hongkonger New Wave, Ringo Lam, Tsui Hark und natürlich John Woo, mit denen er an den seinerzeitigen state of the art des internationalen Bewegungskinos anzudocken suchte. Vielleicht war er hier, im gloriosen und bis heute missverstandenen „Knock Off“ vor allem, für ein paar wenige Filme gar seiner Zeit voraus. Der Zeitgeist freilich war seinerzeit woanders: Die Bruckheimer-Schule kam auf die lukrative Idee, vornehmlich Charakterdarsteller in teuren, polierten Blockbusterkonstrukten zu besetzen und so sehr erfolgreich neue Publikumsschichten zu erschließen. Ein intellektuell sicher nicht avancierterer High-Concept-Actioner wie „The Rock“ oder „Con Air“ wurde so plötzlich interessant für ein Publikum, das sich einen Film mit Van Damme niemals ansehen würde. Um die Jahrtausendwende herum, nach einer Reihe von Flops mit ambitionierten Projekten, schien es dann für eine Weile so, als würde die Luft für Van Damme endgültig dünn. Immer tiefer in den Videothekenregalen verschwanden seine Filme, immer niedriger wurden offenkundig die Budgets und der kreative Aufwand, der für ihre Entstehung betrieben wurde. Als eine Brücke freilich durch dieses Tal der Tränen hin zu einem durch Philippe Martinez’ famosen „Wake of Death“ eingeleiteten Spätwerk, das clever bis melancholisch mit dem eigenen Alterungsprozess umgeht, sind aus heutiger Perspektive die betont finsteren Ringo-Lam-Filme „Replicant“ und „In Hell“ zu lesen, in denen sich jene Dekonstruktion der eigenen Rollenpersona, die nun in „JCVD“ ihren Höhepunkt erreicht, bereits ankündigt. Denn Van Damme, das war bis dahin vor allem: Der Aufrechte. Der Sympathieträger. Auch: der Jungenhafte. Und doch oft, nicht zuletzt: der Melancholiker. Ein Actionheld wider Willen, im Grunde nur zur falschen Zeit am falschen Ort, und ein Stück weit von der Gewalt mitgerissen. In den gemeinsamen Filmen mit Ringo Lam spätestens trat dieses Getriebensein deutlich hervor, und somit entstand eine Abgründigkeit, die erst den Nährboden für das Alterswerk des Jean-Claude Van Damme bilden konnte.
Anders freilich als Steven Seagal, der sich recht bald in sein Schicksal zu ergeben schien und lustlos, resigniert und körperlich verfallend einen unambitionierten Streifen nach dem anderen herunterzukurbeln begann, schien Van Damme eher als tragische Figur greifbar zu werden. In seinem Regiedebüt „The Quest“ oder in Peter MacDonalds „Legionnaire“ versuchte er, im kleinen Maßstab an Hollywoods Tradition des großen, romantischen Abenteuerkinos anzuknüpfen – und lief stets aufs Neue mit dem Kopf gegen die Wand. Mit „Sudden Death“ legte er eine grundsolide Miniatur nach dem klassischen „Die Hard“-Modell vor, mit „Nowhere to Run“ oder „Lionheart“ Versuche eines eher dramatisch begriffenen Aktionskinos. Und dann sind da noch die Arbeiten mit den großen Regisseuren der Hongkonger New Wave, Ringo Lam, Tsui Hark und natürlich John Woo, mit denen er an den seinerzeitigen state of the art des internationalen Bewegungskinos anzudocken suchte. Vielleicht war er hier, im gloriosen und bis heute missverstandenen „Knock Off“ vor allem, für ein paar wenige Filme gar seiner Zeit voraus. Der Zeitgeist freilich war seinerzeit woanders: Die Bruckheimer-Schule kam auf die lukrative Idee, vornehmlich Charakterdarsteller in teuren, polierten Blockbusterkonstrukten zu besetzen und so sehr erfolgreich neue Publikumsschichten zu erschließen. Ein intellektuell sicher nicht avancierterer High-Concept-Actioner wie „The Rock“ oder „Con Air“ wurde so plötzlich interessant für ein Publikum, das sich einen Film mit Van Damme niemals ansehen würde. Um die Jahrtausendwende herum, nach einer Reihe von Flops mit ambitionierten Projekten, schien es dann für eine Weile so, als würde die Luft für Van Damme endgültig dünn. Immer tiefer in den Videothekenregalen verschwanden seine Filme, immer niedriger wurden offenkundig die Budgets und der kreative Aufwand, der für ihre Entstehung betrieben wurde. Als eine Brücke freilich durch dieses Tal der Tränen hin zu einem durch Philippe Martinez’ famosen „Wake of Death“ eingeleiteten Spätwerk, das clever bis melancholisch mit dem eigenen Alterungsprozess umgeht, sind aus heutiger Perspektive die betont finsteren Ringo-Lam-Filme „Replicant“ und „In Hell“ zu lesen, in denen sich jene Dekonstruktion der eigenen Rollenpersona, die nun in „JCVD“ ihren Höhepunkt erreicht, bereits ankündigt. Denn Van Damme, das war bis dahin vor allem: Der Aufrechte. Der Sympathieträger. Auch: der Jungenhafte. Und doch oft, nicht zuletzt: der Melancholiker. Ein Actionheld wider Willen, im Grunde nur zur falschen Zeit am falschen Ort, und ein Stück weit von der Gewalt mitgerissen. In den gemeinsamen Filmen mit Ringo Lam spätestens trat dieses Getriebensein deutlich hervor, und somit entstand eine Abgründigkeit, die erst den Nährboden für das Alterswerk des Jean-Claude Van Damme bilden konnte.
Das alles sollte man wissen, wenn man damit beginnt, über „JCVD“ nachzudenken. Und das weiß auch der Film, der schier genialisch beginnt. In einer langen, wuchtigen Plansequenz prügelt sich da Van Damme durch eine schier endlose Kaskade von Angreifern, wie in alten Zeiten und vielleicht noch ein bisschen toller. Dann, nach Minuten reiner Bewegungspoesie, tritt der Held durch eine Tür, die Tür schlägt zu – und die Kulisse fällt um. Nach hinten. Nicht die vierte Wand fällt, sondern zunächst – wenn man so will – die erste. Bevor sich „JCVD“ später nach vorn öffnet, in den Zuschauerraum und die Welt hinein, öffnet er sich in seine eigene Tiefe und die seines Protagonisten, der Kunstfigur Jean-Claude Van Damme. Dessen Rollengeschichte kommt auch dann zum Tragen, wenn sich der Regisseur des Film-im-Film als Karikatur eines asiatischen Jungfilmers entpuppt, der desinteressiert und voller Verachtung seinem Job nachgeht, während der sichtlich außer Atem geratene Van Damme verzweifelt versucht, etwas Herzblut in den Film einfließen zu lassen. Und außerdem klarstellt, dass er solche langen Plansequenzen mit vollem Körpereinsatz zu drehen kaum noch imstande ist. Schließlich ist er bereits 47 Jahre alt. Die Sequenz, und damit der Titelvorspann, endet mit einem verbrauchten, müden Actionhelden, der seinen Blick direkt in die Kamera und somit auf uns richtet. El Mechri bringt die Bewegungspoesie von Jean-Claude Van Dammes Kino für diesen Moment zum Stillstand, ganz buchstäblich zur Kunstpause. Denn mehr Bewegung ist eben nicht automatisch mehr Poesie. Dies ist kein normaler Jean-Claude-Van-Damme-Film.
 In der Folge sehen wir einem Titelhelden beim verzweifelten Manövrieren in einer Sackgasse seiner Karriere wie seines Privatlebens zu. Von (authentischen) Drogenproblemen geplagt und in einem (ebenso authentischen) Sorgerechtsprozess um Sohn Nicholas aufgerieben, nimmt der Schauspieler eine würdelose C-Picture-Rolle nach der anderen an – und kommt allmählich an dem Punkt an, an dem ihm bereits der noch tiefer gesunkene Kollege Seagal die Rollen wegschnappt. Weil er verspricht, sich sein Zöpfchen abzuschneiden. Kurz vor dem endgültigen Verzweifeln stolpert dieser Actionstar und Antiheld nun in eine Geiselnahme in einem belgischen Postamt hinein – und löst somit eine Kettenreaktion im Innen und Außen des besetzten Raumes aus. Im Inneren insofern, als sich an der Konfrontation mit dem als Kinostar erkannten Van Damme die Konflikte in der Gruppe der Kidnapper verschärfen bis hin zur finalen Eskalation, und im Außen, wo sich alsbald ein gigantischer Medienrummel um den fälschlicherweise für den Verbrecher gehaltenen Van Damme bildet. Der Plot wogt nun ein wenig hin und her – und streift dabei auch durchaus gelegentlich ein wenig ausgetreten wirkendes Tarantino-Territorium –, und löst sich schließlich in einem bittersüßen Ende in Wohlgefallen auf. Die zentrale Sequenz von „JCVD“ findet sich jedoch eher im Zentrum des Films. Da nämlich trägt es den Hauptdarsteller und Helden für mehrere Minuten aus der fiktiven Welt hinaus – beziehungsweise: über diese hinaus. Nicht behind, sondern eher above the scenes spricht Van Damme einen mehrminütigen Monolog direkt in die Kamera, über sein Leben, seine Karriere, sein Scheitern. Über das Versprechen, das er einst dem Publikum gemacht hat und das er bis heute nicht eingelöst sieht. Über seine Sehnsucht, endlich bessere Filme zu machen. Spätestens in dieser Sequenz finden sich endgültig alle Begrenzungen von „JCVD“ niedergerissen, verschwimmen Rollenpersona und Privatperson, Film und Film-im-Film und die Realität zumindest der Klatschspaltenwelt ineinander, gehen Kunstfilm und Genrekino ineinander auf. Hier zeigt sich auch exemplarisch, was „JCVD“ nicht ist. Weder als Pop Art noch als reines Meta-Kino im Geiste Charlie Kaufmans lässt sich Mabrouk El Mechris Film wirklich fassen, und schon gar nicht als schnöde Persiflage. Tatsächlich ist „JCVD“ ein Genrefilm, der das Genre erweitert, statt es hinter sich zu lassen. Der sich elegant darüber erhebt wie sein Held über die Kulissen und zwischen Kameras und Scheinwerfern weiter davon spricht. Keine nachhaltige Dekonstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion, im Geiste jenes Versprechens, das seinen Protagonisten mit uns, seinen Zuschauern, verbindet.
In der Folge sehen wir einem Titelhelden beim verzweifelten Manövrieren in einer Sackgasse seiner Karriere wie seines Privatlebens zu. Von (authentischen) Drogenproblemen geplagt und in einem (ebenso authentischen) Sorgerechtsprozess um Sohn Nicholas aufgerieben, nimmt der Schauspieler eine würdelose C-Picture-Rolle nach der anderen an – und kommt allmählich an dem Punkt an, an dem ihm bereits der noch tiefer gesunkene Kollege Seagal die Rollen wegschnappt. Weil er verspricht, sich sein Zöpfchen abzuschneiden. Kurz vor dem endgültigen Verzweifeln stolpert dieser Actionstar und Antiheld nun in eine Geiselnahme in einem belgischen Postamt hinein – und löst somit eine Kettenreaktion im Innen und Außen des besetzten Raumes aus. Im Inneren insofern, als sich an der Konfrontation mit dem als Kinostar erkannten Van Damme die Konflikte in der Gruppe der Kidnapper verschärfen bis hin zur finalen Eskalation, und im Außen, wo sich alsbald ein gigantischer Medienrummel um den fälschlicherweise für den Verbrecher gehaltenen Van Damme bildet. Der Plot wogt nun ein wenig hin und her – und streift dabei auch durchaus gelegentlich ein wenig ausgetreten wirkendes Tarantino-Territorium –, und löst sich schließlich in einem bittersüßen Ende in Wohlgefallen auf. Die zentrale Sequenz von „JCVD“ findet sich jedoch eher im Zentrum des Films. Da nämlich trägt es den Hauptdarsteller und Helden für mehrere Minuten aus der fiktiven Welt hinaus – beziehungsweise: über diese hinaus. Nicht behind, sondern eher above the scenes spricht Van Damme einen mehrminütigen Monolog direkt in die Kamera, über sein Leben, seine Karriere, sein Scheitern. Über das Versprechen, das er einst dem Publikum gemacht hat und das er bis heute nicht eingelöst sieht. Über seine Sehnsucht, endlich bessere Filme zu machen. Spätestens in dieser Sequenz finden sich endgültig alle Begrenzungen von „JCVD“ niedergerissen, verschwimmen Rollenpersona und Privatperson, Film und Film-im-Film und die Realität zumindest der Klatschspaltenwelt ineinander, gehen Kunstfilm und Genrekino ineinander auf. Hier zeigt sich auch exemplarisch, was „JCVD“ nicht ist. Weder als Pop Art noch als reines Meta-Kino im Geiste Charlie Kaufmans lässt sich Mabrouk El Mechris Film wirklich fassen, und schon gar nicht als schnöde Persiflage. Tatsächlich ist „JCVD“ ein Genrefilm, der das Genre erweitert, statt es hinter sich zu lassen. Der sich elegant darüber erhebt wie sein Held über die Kulissen und zwischen Kameras und Scheinwerfern weiter davon spricht. Keine nachhaltige Dekonstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion, im Geiste jenes Versprechens, das seinen Protagonisten mit uns, seinen Zuschauern, verbindet.
JCVD
(Belgien / Luxemburg / Frankreich 2008)
Regie: Mabrouk El Mechri; Buch: Mabrouk El Mechri, Frédéric Benudis, Christophe Turpin; Musik: Gast Waltzing; Kamera: Pierre-Yves Bastard; Schnitt: Kako Kelber
Darsteller: Jean-Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem, Karim Belkhadra, Jean-François Wolff, Anne Paulicevich, Liliane Becker u.a.
Länge: 93 Min.
Verleih: Koch Media
Zur DVD von Koch Media
Mit der 2-Disc Edition hat Koch Media einmal mehr eine tadellose DVD-Veröffentlichung vorgelegt. Die Bild- und Tonqualität ist tadellos, und insbesondere mit den zwei langen Dokumentationen auf der Bonus-DVD sowie der Teaser-Kollektion auf der Film-DVD, bei der es sich im Grunde um eine Reihe eigenständiger Kurzfilme handelt, ist einiges höchst interessante Material zur weiteren Kontextualisierung und Vertiefung des Filmes vorhanden.
Bild: 2,35:1
Ton: Deutsch, Französisch/Englisch (DTS, Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Audiokommentar mit Mabrouk El Mechri, 6 Teaser, Geschnittene Szenen mit optionalem Kommentar des Regisseurs, Vent d’Ame (Making of), Ein Tag im Leben von JCVD, Synchro-Outtake mit Charles Rettinghaus
FSK: ab 16 Jahren
Berührung und Differenz
Der zweite (oder, wie mancher wohl behaupten würde, erste) Frühling des Dolph Lundgren ist zweifelsohne zu den überraschendsten Karrieren im noch jungen Kino des 21. Jahrhunderts zu zählen – und, wie passend, wohl hauptsächlich dem Zufall zu verdanken. Das erstaunliche Comeback Lundgrens als Actiondarsteller ist immerhin ganz wesentlich mit dessen neuem Profil als Autorenfilmer verbunden, und diese Rolle ist wohl in erster Linie dem labilen Gesundheitszustand Sidney J. Furies zu verdanken. Erst als dieser kurz vor Drehbeginn von „The Defender“ passen musste, übernahm nämlich Lundgren die Regie des schon detailliert geplanten Projektes – und verlieh dem Film doch einen individuellen, frischen Touch, der unter Furies Regie so kaum vorstellbar wäre. In der Folge bestätigte Lundgren sein Talent mit den weiteren Regiearbeiten „The Mechanik“ und „Missionary Man“ (sowie dem offiziell von Shimon Dotan inszenierten, Gerüchten zufolge aber während der Dreharbeiten von Lundgren übernommenen, in impressionistischen Stimmungsbildern schwelgenden „Diamond Dogs“) nicht nur, sondern schien gar von Film zu Film souveräner und ambitionierter zu werden. Mit „Direct Contact“ begab er sich nun zum ersten Mal seit 2004 – den obskuren Bibelfilm „L’Inchiesta“, in dem Lundgren in einer Nebenrolle auftaucht, mal außer Acht gelassen – in die Hände eines anderen Regisseurs, und prompt hält auch durchaus eine gewisse stilistische Wankelmütigkeit Einzug. So ungebrochen stilisiert wie Lundgren in seinen Postwestern geht Danny Lerner kaum ans Werk, und tatsächlich verfügt „Direct Contact“ über eine ganze Reihe von Charakteristika, die ihn nach klassisch filmkritischem Verständnis wohl als „misslungen“ markieren würden.
 So ist etwa zu den auffälligeren Merkmalen von Lerners Film der extensive Einsatz von stock footage zu zählen – eine klassische Verfahrensweise des B-Movies, einem Werk mehr Schauwert zu verleihen, als das schmale Budget hergibt. Statt aufwendige Aktionssequenzen zu inszenieren (oder Naturaufnahmen an exotischen Schauplätzen, oder eben alles, was sich als Erscheinungsform „reinen Spektakels“ in den Film integrieren lässt), greift der Filmemacher hier auf bereits vorhandenes, in früheren Filmproduktionen verwendetes oder im Archiv gelagertes Material zurück und verfügt nun bereits über eine Reihe von Eckpunkten, um die herum er nun das neu inszenierte Material zu arrangieren hat. Dies stellt nun natürlich vor die Herausforderung, aus diesen unter Umständen vollkommen disparaten Versatzstücken heraus eine Art Geschlossenheit herzustellen, die die unterschiedlichen Genealogien des verwendeten Materials möglichst perfekt verschleiert. Zumindest wäre dies die Anforderung, die zur klassischen Vorstellung eines „gut gemachten“ Films im Sinne des amerikanischen Modells führen würde: eine unsichtbare Montage mit dem Ziel der Kreation einer möglichst ungebrochenen filmischen Ganzheit, hier eben nur vor eine zusätzliche Hürde gestellt. Der grundsätzlich illusionistische Charakter des Kinos wäre im Rahmen einer solchen Perspektive absolut und nicht in Frage zu stellen, und einen Film zu machen, das wäre diesem Modell zufolge ein bisschen so, wie einen Pullover zu stricken. Ein Handwerk, das grundsätzlich ähnliche Vorgehensweisen seitens des Ausführenden, der demzufolge kaum Künstler, höchstens Kunsthandwerker wäre, erfordert, und das sich verkompliziert mit der Anzahl der Fäden, die hier zu verschlingen und im Überblick (produzenten- wie rezipientenseitig) zu behalten sind. Das mag zwar im Falle gewisser Ansprüche an das Kino eine legitime Sichtweise sein, es ist gleichwohl natürlich auch eine äußerst langweilige, schon deswegen, weil sie in letzter Konsequenz auf ein bloßes Abfragen eines Filmes nach einem immer gleichen Kriterienkatalog hinausläuft und somit auf eine ewig redundante Bestätigung und Reproduktion eines Wissens vom Kino, das man immer und immer wieder auch schon vorher hatte.
So ist etwa zu den auffälligeren Merkmalen von Lerners Film der extensive Einsatz von stock footage zu zählen – eine klassische Verfahrensweise des B-Movies, einem Werk mehr Schauwert zu verleihen, als das schmale Budget hergibt. Statt aufwendige Aktionssequenzen zu inszenieren (oder Naturaufnahmen an exotischen Schauplätzen, oder eben alles, was sich als Erscheinungsform „reinen Spektakels“ in den Film integrieren lässt), greift der Filmemacher hier auf bereits vorhandenes, in früheren Filmproduktionen verwendetes oder im Archiv gelagertes Material zurück und verfügt nun bereits über eine Reihe von Eckpunkten, um die herum er nun das neu inszenierte Material zu arrangieren hat. Dies stellt nun natürlich vor die Herausforderung, aus diesen unter Umständen vollkommen disparaten Versatzstücken heraus eine Art Geschlossenheit herzustellen, die die unterschiedlichen Genealogien des verwendeten Materials möglichst perfekt verschleiert. Zumindest wäre dies die Anforderung, die zur klassischen Vorstellung eines „gut gemachten“ Films im Sinne des amerikanischen Modells führen würde: eine unsichtbare Montage mit dem Ziel der Kreation einer möglichst ungebrochenen filmischen Ganzheit, hier eben nur vor eine zusätzliche Hürde gestellt. Der grundsätzlich illusionistische Charakter des Kinos wäre im Rahmen einer solchen Perspektive absolut und nicht in Frage zu stellen, und einen Film zu machen, das wäre diesem Modell zufolge ein bisschen so, wie einen Pullover zu stricken. Ein Handwerk, das grundsätzlich ähnliche Vorgehensweisen seitens des Ausführenden, der demzufolge kaum Künstler, höchstens Kunsthandwerker wäre, erfordert, und das sich verkompliziert mit der Anzahl der Fäden, die hier zu verschlingen und im Überblick (produzenten- wie rezipientenseitig) zu behalten sind. Das mag zwar im Falle gewisser Ansprüche an das Kino eine legitime Sichtweise sein, es ist gleichwohl natürlich auch eine äußerst langweilige, schon deswegen, weil sie in letzter Konsequenz auf ein bloßes Abfragen eines Filmes nach einem immer gleichen Kriterienkatalog hinausläuft und somit auf eine ewig redundante Bestätigung und Reproduktion eines Wissens vom Kino, das man immer und immer wieder auch schon vorher hatte.
 Tritt man nun aber, jenseits des „gut“ oder „schlecht Gemachten“ in ein Kommunikationsverhältnis zu dem Film „Direct Contact“, so tun sich mit einem Mal Sinnebenen auf, welche die Beschäftigung mit diesem Artefakt sehr gewinnbringend erscheinen lassen können. Schon der Titel „Direct Contact“ wird nun als Kommentar auf die Struktur des Filmes lesbar, indem er seine inhärente Doppeldeutigkeit entfaltet. Der Kontakt, das meint schließlich nicht nur die Nähe, sondern immer gleichzeitig auch die Distanz; die Berührung betont stets auch die grundlegende Alterität. Und Danny Lerners Film oszilliert zwischen diesen beiden Polen: Die mangelnde Perfektion in seiner Bemühung, eine durchgehende kinematographische Bewegung im Collagieren von disparatem Material auszuformen, reißt Lücken zwischen den Bildern auf, durch die der filmische Produktionsprozess durchscheint. Somit lässt sich „Direct Contact“ etwa ebenso mühelos als Allegorie auf den arbeitsteiligen Prozess des Filmemachens selbst wie als konsequente Offenlegung des illusionistischen Charakters der Montage lesen. Im Auseinanderklaffen zwischen zwei Sequenzen – mehr noch: zwischen Ursache und Wirkung – kommt das grundsätzlich Achronologische des Kinos ins Spiel, das durch avanciertere Montagetechniken fürgewöhnlich aus dem Blickfeld gerät, und zersetzt die nicht mehr als geschlossen wahrnehmbare Welt der filmischen Narration. Der Stellenwert der Aktionssequenz selbst verschiebt sich also vor der Erzählweise von „Direct Contact“, der dies auch in seinen schönsten Momenten buchstäblich zelebriert. So in einer der zahlreichen Autoverfolgungsjagden, die den Helden Mike Riggins durch den sich immer wieder umschichtenden Plot um ein Kidnapping, das sich in der Flexibilisierung der Frontlinien durch die diversen Demaskierungen des Verschwörungsplots gewissermaßen verdoppelt, tragen: Funken sprühen, Glas splittert, farbiges Licht und Explosionen gemahnen hier vor allem an ein Feuerwerk. Die Herauslösung des Spektakels aus dem Filmganzen und die Überführung in für sich selbst stehende, isolierte Bilder, von jenen den Plot transportierenden Sequenzen geradezu umflossen, lassen diese Momente von einem Hauch des Erhabenen umwehen. Die Explosion, die Destruktion, das Spektakel, der Schauwert – das alles ist hier nicht mehr als ein Bestandteil (unter verschiedenen, gleichwertigen) des Filmbildes zu klassifizieren. Stattdessen wird es zu seinem Fluchtpunkt.
Tritt man nun aber, jenseits des „gut“ oder „schlecht Gemachten“ in ein Kommunikationsverhältnis zu dem Film „Direct Contact“, so tun sich mit einem Mal Sinnebenen auf, welche die Beschäftigung mit diesem Artefakt sehr gewinnbringend erscheinen lassen können. Schon der Titel „Direct Contact“ wird nun als Kommentar auf die Struktur des Filmes lesbar, indem er seine inhärente Doppeldeutigkeit entfaltet. Der Kontakt, das meint schließlich nicht nur die Nähe, sondern immer gleichzeitig auch die Distanz; die Berührung betont stets auch die grundlegende Alterität. Und Danny Lerners Film oszilliert zwischen diesen beiden Polen: Die mangelnde Perfektion in seiner Bemühung, eine durchgehende kinematographische Bewegung im Collagieren von disparatem Material auszuformen, reißt Lücken zwischen den Bildern auf, durch die der filmische Produktionsprozess durchscheint. Somit lässt sich „Direct Contact“ etwa ebenso mühelos als Allegorie auf den arbeitsteiligen Prozess des Filmemachens selbst wie als konsequente Offenlegung des illusionistischen Charakters der Montage lesen. Im Auseinanderklaffen zwischen zwei Sequenzen – mehr noch: zwischen Ursache und Wirkung – kommt das grundsätzlich Achronologische des Kinos ins Spiel, das durch avanciertere Montagetechniken fürgewöhnlich aus dem Blickfeld gerät, und zersetzt die nicht mehr als geschlossen wahrnehmbare Welt der filmischen Narration. Der Stellenwert der Aktionssequenz selbst verschiebt sich also vor der Erzählweise von „Direct Contact“, der dies auch in seinen schönsten Momenten buchstäblich zelebriert. So in einer der zahlreichen Autoverfolgungsjagden, die den Helden Mike Riggins durch den sich immer wieder umschichtenden Plot um ein Kidnapping, das sich in der Flexibilisierung der Frontlinien durch die diversen Demaskierungen des Verschwörungsplots gewissermaßen verdoppelt, tragen: Funken sprühen, Glas splittert, farbiges Licht und Explosionen gemahnen hier vor allem an ein Feuerwerk. Die Herauslösung des Spektakels aus dem Filmganzen und die Überführung in für sich selbst stehende, isolierte Bilder, von jenen den Plot transportierenden Sequenzen geradezu umflossen, lassen diese Momente von einem Hauch des Erhabenen umwehen. Die Explosion, die Destruktion, das Spektakel, der Schauwert – das alles ist hier nicht mehr als ein Bestandteil (unter verschiedenen, gleichwertigen) des Filmbildes zu klassifizieren. Stattdessen wird es zu seinem Fluchtpunkt.
Direct Contact
(USA/Deutschland 2009)
Regie: Danny Lerner; Buch: Danny Lerner, Les Welden; Musik: Stephen Edwards; Kamera: Ross W. Clarkson; Schnitt: Michele Gisser
Darsteller: Dolph Lundgren, Michael Paré, Gina May, James Chalke, Bashar Rahal, Vladimir Vladimirov, Raicho Vasilev, Nikolay Stanoev u.a.
Länge: 87 Min.
Verleih: Kinowelt
Zur DVD von Kinowelt
Qualitativ ist die DVD von Kinowelt tadellos ausgefallen. Die Bild- und Tonqualität sind hervorragend, die deutsche Synchronfassung ist durchaus akzeptabel ausgefallen. Bonusmaterial ist hingegen so gut wie keines vorhanden, jedenfalls nichts von Interesse.
Bild: 1,78:1
Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Surround), Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Trailer, Fotogalerie
FSK: JK – Keine schwere Jugendgefährdung
Geretteter Lebensretter aus Todessehnsucht
Zuerst nur ein dumpfer Herzschlag, millisekundenkurze Bilder, viel Schwarz. Ein Autounfall, eine schöne und vielleicht auch tote Frau. Ein Schrei. Schwarz. Dann ein kurzer, so prägnanter wie lakonischer (und schlussendlich ambivalenter) Titelcredit: „Hero Wanted“.
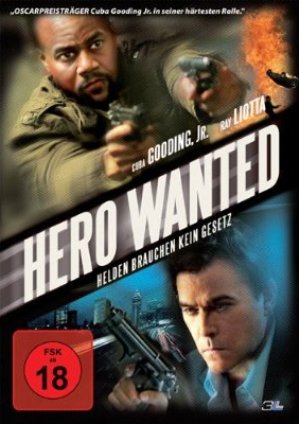 „I really wish we hadn’t started here.“ Wir finden uns in diesen Film geworfen und treffen auf seinen Protagonisten als jemanden, der bereits in einem grundlegenden Danach gefangen ist. Immer schon alles zu spät: Volltrunken in einer Bar, über die Theke kotzend. Augenblickskurze Flashbacks, eine tote Ehefrau, schwanger, gestorben in einem Autounfall. Liam Case (Cuba Gooding, Jr.) erscheint in diesen Momenten wie ein Schlafwandler, der unberührt durch die Ruine seines Lebens streift – bis ihn (und uns) ein ohrenbetäubender Crash aus der Lethargie herausreißt. Erneut ein Autounfall, und ohne einen Augenblick zu zögern, stürzt sich Liam in das brennende Wrack, um ein kleines Mädchen vor dem Flammentod zu retten. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau, so teilt er uns mit, habe er etwas Sinnvolles getan. Ein Leben gerettet, „but not tonight“. Sekunden später sehen wir Liam mit einer Waffe in der Hand, einen Anschlag auf den fröhlich masturbierenden Gangster Lynch McGraw vorbereitend. Wieder ein Schnitt, und das bedeutet hier stets: wieder ein Sprung ins Ungewisse. Nun finden wir Liam in einer Bank wieder, schüchtern mit einer Angestellten flirtend und schließlich in einen eskalierenden Überfall verwickelt. Einer der Bankräuber verliert die Nerven, schießt der jungen Frau in den Kopf, auch Liam, der ihr zu helfen versucht, fängt sich eine Kugel ein. Noch ein Schnitt, Krankenhaus, Liam am Krankenbett der ins Koma gefallenen Bankangestellten. Dann wieder die Waffe: ein Rachefeldzug, erzählt in schlingernden Zeitpirouetten. Den Tod des mit einem Wok brutalst zu Tode geprügelten Lynch sehen wir zunächst nur in seiner Konsequenz, durch die Augen des ermittelnden Polizisten Terry Subcott (Ray Liotta). Dann endlich formieren sich jene grundsätzlich durchaus geradlinigen Bewegungen, die den Plot des ungewöhnlichen Action-B-Movies „Hero Wanted“ über den größeren Teil seiner Laufzeit tragen werden: Subcott sucht, wenngleich wenig leidenschaftlich, den Mörder McGraws, während dessen Bruder Skinner (Kim Coates) Vergeltung sucht – nur um ebenfalls kaltblütig von Case getötet zu werden. Der Konflikt spitzt sich zwischen diesem und dem ebenfalls am Banküberfall beteiligten Psychopathen Derek (Thomas Flannigan) und Liam zu – welche Verbindung jedoch zwischen diesem und den Räubern besteht, welche Rolle sein Freund Swain (Norman Reedus) spielt, und vor allem: in welchem Verhältnis genau nun Heldenmut und kriminelle Umtriebe stehen, das alles wird sich erst im Verlauf des Filmes entwirren.
„I really wish we hadn’t started here.“ Wir finden uns in diesen Film geworfen und treffen auf seinen Protagonisten als jemanden, der bereits in einem grundlegenden Danach gefangen ist. Immer schon alles zu spät: Volltrunken in einer Bar, über die Theke kotzend. Augenblickskurze Flashbacks, eine tote Ehefrau, schwanger, gestorben in einem Autounfall. Liam Case (Cuba Gooding, Jr.) erscheint in diesen Momenten wie ein Schlafwandler, der unberührt durch die Ruine seines Lebens streift – bis ihn (und uns) ein ohrenbetäubender Crash aus der Lethargie herausreißt. Erneut ein Autounfall, und ohne einen Augenblick zu zögern, stürzt sich Liam in das brennende Wrack, um ein kleines Mädchen vor dem Flammentod zu retten. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau, so teilt er uns mit, habe er etwas Sinnvolles getan. Ein Leben gerettet, „but not tonight“. Sekunden später sehen wir Liam mit einer Waffe in der Hand, einen Anschlag auf den fröhlich masturbierenden Gangster Lynch McGraw vorbereitend. Wieder ein Schnitt, und das bedeutet hier stets: wieder ein Sprung ins Ungewisse. Nun finden wir Liam in einer Bank wieder, schüchtern mit einer Angestellten flirtend und schließlich in einen eskalierenden Überfall verwickelt. Einer der Bankräuber verliert die Nerven, schießt der jungen Frau in den Kopf, auch Liam, der ihr zu helfen versucht, fängt sich eine Kugel ein. Noch ein Schnitt, Krankenhaus, Liam am Krankenbett der ins Koma gefallenen Bankangestellten. Dann wieder die Waffe: ein Rachefeldzug, erzählt in schlingernden Zeitpirouetten. Den Tod des mit einem Wok brutalst zu Tode geprügelten Lynch sehen wir zunächst nur in seiner Konsequenz, durch die Augen des ermittelnden Polizisten Terry Subcott (Ray Liotta). Dann endlich formieren sich jene grundsätzlich durchaus geradlinigen Bewegungen, die den Plot des ungewöhnlichen Action-B-Movies „Hero Wanted“ über den größeren Teil seiner Laufzeit tragen werden: Subcott sucht, wenngleich wenig leidenschaftlich, den Mörder McGraws, während dessen Bruder Skinner (Kim Coates) Vergeltung sucht – nur um ebenfalls kaltblütig von Case getötet zu werden. Der Konflikt spitzt sich zwischen diesem und dem ebenfalls am Banküberfall beteiligten Psychopathen Derek (Thomas Flannigan) und Liam zu – welche Verbindung jedoch zwischen diesem und den Räubern besteht, welche Rolle sein Freund Swain (Norman Reedus) spielt, und vor allem: in welchem Verhältnis genau nun Heldenmut und kriminelle Umtriebe stehen, das alles wird sich erst im Verlauf des Filmes entwirren.
„Sometimes, things worth dying for are worth living for.“ Auf den ersten Blick ist „Hero Wanted“, das Regiedebüt des als Second Unit Regisseur und Stuntkoordinator in Hollywoods Größtproduktionen erfahrenen Brian Smrz, auffällig fragmentarisch erzählt. Zwar gelingt es Smrz durchaus, im ersten Filmdrittel eine (ungefähre) Konstellation von (Anti-)Held und Antagonisten zu konstruieren – mit einem seltsam äußerlich anmutenden Nebenplot um den als eindeutiger der Lichtseite zuneigenden Doppelgänger inszenierten Cop Subcott, der sich erst am Ende in das Gesamtsystem des Films einschmiegt –, doch lässt er sich niemals auf einen schnörkellosen Verlauf seiner im Grunde schlichten Narration ein. Tatsächlich scheint sich diese eher festzuhaken an einer Reihe von „unerhörten Begebenheiten“, um jene dann schier manisch zu umkreisen. Diese Erzählweise wirft eher Fragen nach Schuld, Leid, Verlust auf als bloß das Verlangen nach dem nächsten Plot Point – Liam Case ist Mörder und Retter zugleich, ein trauriger Rächer, verflucht gleichermaßen von der Last der guten wie der bösen Tat. Zerrissen zwischen divergierenden Bildern seiner selbst, die stets zu groß für ihn sind. Im Schlussdrittel von „Hero Wanted“ werden sich dann die Verstrickungen aufklären, und spätestens hier wird klar, dass jegliche scheinbare Abschweifung stets nur wieder zu Liam zurückführt, dass tatsächliche das komplette (moralische wie narrative) System des Films ausschließlich um diese eine zentrale Figur herum inszeniert ist. Hierin spiegelt sich die solipsistische Weltwahrnehmung und Handlungsweise dieses Antihelden, und konsequenterweise ereignet sich die katastrophische Eskalation dann auch jeweils durch das Eindringen äußerlicher Faktoren, welche die „simplen Pläne“ Liams – mit unbeholfenen Mitteln das Gute wollend und das Böse schaffend – zum Scheitern bringen. Der vorgetäuschte Banküberfall, der unvermittelt zum „echten“ wird und sehr reale Folgen zeitigt – so ähnlich übrigens, vielleicht ja gar nicht zufällig, eines der Grundmomente in Baudrillards „Agonie des Realen“ –; der scheinbare Mut, der aus der Feigheit geboren ist; der gerettete Lebensretter aus Todessehnsucht: „Hero Wanted“ ist ein hochinteressanter Beitrag zum jüngeren DTV-Actionkino, der sich diesen Widersprüchlichkeiten nicht nur stellt, sondern der sie nachgerade fetischistisch umkreist und sie letztlich zum eigentlichen Motor seiner physischen wie narrativen Bewegungen macht.
Hero Wanted
(USA 2008)
Regie: Brian Smrz; Buch: Chad Law, Evan Law; Musik: Kenneth Burgomaster; Kamera: Larry Blanford; Schnitt: Tim Anderson
Darsteller: Cuba Gooding, Jr., Ray Liotta, Norman Reedus, Kim Coates, Thomas Flannigan, Jean Smart, Christa Campbell, Steven Kozlowski, Ben Cross u.a.
Länge: 91 Min.
Verleih: 3L Filmverleih
Zur DVD von 3L Filmverleih
Der bemerkenswerte Film erscheint in angemessener Bild- und Tonqualität und in ungekürzter Fassung auf DVD. Das Bonusmaterial hat (neben Trailern und einer Bildergalerie) lediglich eine unkommentierte Featurette zu den Dreharbeiten sowie einige sehr kurze Statements der beteiligten Schauspieler und Filmemacher zu bieten.
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch (DTS, Dolby Digital 5.1), Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Hinter den Kulissen, Statements zum Film von Darstellern & Crew, Deutscher Trailer, Originaltrailer, Bildergalerie
FSK: Keine Jugendfreigabe
Wichtig ist auf dem Platz
Ein Rennen in mehreren Etappen, quer über den amerikanischen Kontinent. Nicht der Schnellere, sondern der Überlebende ist der Sieger – und für das Überfahren wehrloser Passanten gibt es Bonuspunkte. Soweit die einigermaßen zynische Ausgangsthese, um die herum Regisseur Paul Bartel 1975 für Produzent Roger Corman und mit geschätzten 8 Dollar 50 Budget den mittlerweile zum kleinen Klassiker avancierten Exploitationfilm „Death Race 2000“ inszenierte. Die offensichtlichen finanziellen Beschränkungen verboten hierbei allzu ausufernde oder aufwendige Actionsequenzen, und aus dieser Not machte Bartel eine Tugend, indem er sich mehr auf die satirischen denn auf die spektakulären Aspekte des Stoffes stürzte und diesen in eine grell-groteske Komödie einschrieb. Die Antihelden von „Death Race 2000“ – nachdrücklich verkörpert von David Carradine sowie einem exaltiert grimassierenden Sylvester Stallone nur ein Jahr vor seinem großen Durchbruch mit „Rocky“ – sind überlebensgroße Karikaturen in bunten Zirkuskostümen, die sich mit kaltschnäuzigem Augenzwinkern den menschenverachtenden Spielregeln des Rennens beugen. Mindestens ebenso viel Emphase legt Bartel aber auf die Darstellung der Begleitumstände des sympathisch bodenständig inszenierten Spektakels. Von zynischen Kommentatoren und einem geifernden, allgegenwärtigen und blutlüsternen Publikum begleitet, stellt das Rennen hier eine Art moderne Version der Gladiatorenkämpfe dar – eine absurd überspitzte Form der Mediensatire, die etwa in den großen Science-Fiction-Filmen von Paul Verhoeven eine Fortschreibung erfuhr. Einen zumindest dem oberflächlichen Blick völlig konträr erscheinenden Ansatz wählte nun Regisseur Paul W.S. Anderson, der sich mit Filmen wie „Resident Evil“ oder „Alien vs. Predator“ nicht eben viele Lorbeeren verdiente, für sein 33 Jahre später vorgelegtes Remake „Death Race“.
Viel Plot, wenig Geheimnis
Am Anfang steht das Postkartenpanorama: Charles Bronson ist Joe Martin, Ruheständler an der malerischen Côte d’Azur, und gemeinsam mit ihm und den Eröffnungscredits schippern wir per Boot in diesen Film hinein. „De la part des copains“, wie der Vorspann verrät, oder eben „Kalter Schweiß“ – der deutsche Kinotitel, mit dem der Verleih anno 1970 wohl versuchte, den eher klassisch erzählten Euro-Actioner als knüppelharten Reißer anzupreisen.
Dr. Snuggles und Mr. Hyde
Michel Gondry stünden bei der Betrachtung von „Die Reise ins Glück“ sicherlich Tränen des Glücks in den Augen: Jene Ästhetik des Selbstgebastelten, die der geniale Franzose im Grunde schon immer und jüngst nachdrücklich in „Be Kind Rewind“ propagierte, findet sich nämlich in das Opus magnum des deutschen Independent-Autorenfilmers Wenzel Storch aufs Schönste eingeschrieben. Überhaupt handelt es sich hier um einen Film, dessen Entstehung im Grunde nur durch einen Faktor erklärbar ist: Liebe.
„Dr. Snuggles und Mr. Hyde“ weiterlesen
Objects in the mirror are closer than they appear
Kim Sung-Hos „Into the Mirror“ von 2003 war ein recht eleganter Beitrag zur bis heute ungebrochenen Welle asiatischer Geisterfilme, der in allerlei Schnörkeln um den im Grunde schlichten Plot herum jede Möglichkeit nutzte, seine zentrale Spiegelmetapher auszureizen und zumindest visuell immer weiter zu treiben. Immer neue Rahmungen, Spiegelungen und Reflexionen zogen dem Betrachter den sicheren narrativen Boden unter den Füßen weg, bis Kim seine Erzählung in einer konsequenten und schlussendlich tieftraurigen Pointe kulminieren ließ. Mit „Mirrors“ legt Alexandre Aja nun seine Variation auf das Motiv für den US-Markt vor – und somit auch sein zweites Remake in Folge.
„Objects in the mirror are closer than they appear“ weiterlesen
All diese Farben, die nie verblassen
Am Anfang steht ein Zitat, in Form eines kleinen Origami-Einhorns. Ein solches nämlich hatte Rick Deckard, dem „Blade Runner“ aus Ridley Scotts 1982er Meisterwerk, Aufschluss darüber gegeben, dass er selbst ein Replikant war. Einer jener androidischen Sklaven, denen die Menschen ein knapp begrenztes Leben geschenkt haben, einer von jenen, die er Zeit seines Lebens gejagt und getötet hat. Deckard schaut das Einhorn nur einen Moment lang an, nickt dann und betritt den Fahrstuhl, in dem die schöne Rachael auf ihn wartet. Die Fahrstuhltüren schließen sich, der Film ist (zumindest in der Director’s-Cut-Fassung) zu Ende. „I.K.U.“, jenes „Sci-Fi Porn Movie“ von der als Video-, Multimedia- und Internetkünstlerin bekannt gewordenen Shu Lea Cheang, beginnt an diesem Punkt erst. Bis zum Schließen der Türen folgt Cheang noch dem Vorbild, doch dann schneidet sie in den Innenraum des Fahrstuhls, wo sich jener heiße Sex ereignet, den Ridley Scott noch der Phantasie des Publikums überließ.
Die Gegenwart gibt es nicht
Die Gegenwart, sagt Godard, kommt im Kino nicht vor, außer in den schlechten Filmen. Gilles Deleuze erweitert dieses etwas enigmatische Diktum in seiner Kinotheorie zu einem Modell, dem zufolge die Gegenwart im Kinobild sich in zwei Strahlen aufspalte, deren einer zu den Vergangenheiten und deren anderer zu den Zukünften führt, mit denen sie nicht linear verbunden sind, sondern die sie als Potenzialitäten in sich tragen. Die Gegenwart kann folglich nicht existieren, ohne im gleichen Moment bereits als zukünftige Vergangenheit gedacht zu werden. Deleuze konkretisiert diesen Gedanken in einem an Bergsons Zeittheorie angelehnten doppelten Kegelmodell, in dem jeder Zeitabschnitt einen beweglichen Schnitt markiert und die Gegenwart den Ort der größtmöglichen Verengung darstellt – ohne jemals wirklich Punkt sein zu können. Dieses Modell nähert das Kino dem Augustinischen Gedanken einer „Gegenwart des Vergangenen, Gegenwart des Gegenwärtigen und Gegenwart des Zukünftigen“ an und zielt darauf ab, so Deleuze, das, was vor und nach dem Film ist, ins Innere des Films zu versetzen und so die einfache, sukzessive Verkettung vorüberziehender Gegenwarten aufzusprengen.

