Erinnert sich noch jemand an diese Zorrokostüme, die es früher (immer noch?) für Kinder zu kaufen gab? Meist bestanden diese aus einem schwarzen Umhang, einem Hut und einer Maske, manchmal war auch noch ein Plastikdegen dabei. Das auf dem Hut aufgeklebte „Z“ schien mir als Kind noch akzeptabel, dass Zorro jedoch einen Umhang getragen haben sollte, auf dem sowohl sein Name als auch sein Konterfei prangte, hielt ich damals schon für fragwürdig: Als bedürfe es der unnötigen Bestätigung einer doch unumstößlichen Gewissheit. Mit Xavier „Hitman“ Gens’ Horrorfilm und TCM-Hommage „Frontiére(s)“ und seinen Artgenossen – „Hostel“, „Turistas“, den „TCM-“ und „Hills have Eyes“-Remakes und -Prequels etwa – verhält es sich ganz ähnlich wie mit jenen gutgemeinten Zorrokostümen: Sie verdoppeln gewissermaßen ihren Inhalt, legen ihn offen, holen ihn aus dem Schatten des Impliziten ins grelle Licht des Offenkundigen – und zerstören damit im schlimmsten Fall ihre eigene Prämisse. „Bei Knopps Zuhause“ weiterlesen
Der Film ohne Grund
Zack Snyder gelang vor vier Jahren mit „Dawn of the Dead“ das außergewöhnlich gute Remake des gleichnamigen und unsterblichen Klassikers von George Romero, obwohl einem doch schon die Idee, dass sich jemand an diesem vergreifen wollte, wie ein Sakrileg erschien. Was für ein unwahrscheinlicher Glücksfall diese Neuauflage tatsächlich war, wird einem schmerzhaft bewusst, wenn man das nach deren Erfolg unvermeidliche Remake von „Day of the Dead“, dem dritten Teil von Romeros ursprünglicher Zombie-Trilogie und dem direkten Nachfolger von „Dawn“, durchleidet. Das einzige, was man diesem ohne Sinn und Verstand zusammengeschusterten Rohrkrepierer zugutehalten kann: Er versucht gar nicht erst, ein echter Film zu sein, sondern begnügt sich ganz mit der Funktion des Wegwerfprodukts für Splatternerds. Aber auch als solches versagt er auf ganzer Linie. „Der Film ohne Grund“ weiterlesen
Die Depression nach dem Wirtschaftswunder
In einem Monat, in dem Autos als fahrende Fahnenmasten in Erscheinung treten, wirkt eine Serie wie „PS – Geschichten ums Auto“ noch fremdartiger als sie es rund 30 Jahre nach ihrer Entstehung eh schon ist. Keine Rede ist hier von Ökosprit, Navigationsgeräten, Klimaanlagen oder Freisprechanlagen, völlig abwesend sind pastellene Trendfarben, ornamentale Felgen und aerodynamische Formen. Wenn hier Schäden mit Kfz-Mechanikern diskutiert werden oder der Verkäufer die Vorzüge des Gefährts preist, dann meint man, ein Auto würde von einem vierschrötigen Herrn im grauen Kittel nach den Lehren einer geheimen Wissenschaft aus einem riesigen Brocken Eisenerz herausgemeißelt, nur um dann wie durch Geisterhand in Bewegung zu geraten. Um die Befremdung, die den Zuschauer dieser Serie unweigerlich ereilt, verständlich zu machen: Das Auto wird in „PS – Geschichten ums Auto“ als technisches Mysterium dargestellt und als Statussymbol, das eine einfache Familie an den finanziellen Abgrund führen kann. Aber verkörpern soll diese Eigenschaften ausgerechnet ein Fiat Amalfi … „Die Depression nach dem Wirtschaftswunder“ weiterlesen
Finding Nero
Ein rast- und heimatloser Revolverheld, der den Mord an seinem Bruder rächen will; eine Stadt voller geldgieriger Lügner, Heuchler und feiger Mörder; ein cholerischer mexikanischer Rebell mit abgehacktem Arm; ein Finale, in dem die gedemütigte Stadtbevölkerung nackt im Staub der Hauptsraße herumkriecht: Die Weichen scheinen gestellt für für einen Film, mit dem Corbucci an seine Meisterwerke „Django“ und „Leichen pflastern seinen Weg“ anknüpft. Aber „Fahrt zur Hölle, ihr Halunken“ teilt mit diesen beiden Klassikern nur wenig – leider. „Finding Nero“ weiterlesen
Kompromissfreudige Vorarbeit
Zwei der wohl interessantesten Filmemacher der Gegenwart erhalten die hierzulande längst überfällige Publikation. Der Freude über diese folgt aber schon nach einem flüchtigen Blick die Ernüchterung. Der Band bringt es gerade einmal auf schmale 200 Seiten, von denen 20 auf Bio-, Filmo- und Bibliografien entfallen.
Die Herrschaft des Pöbels
In einem Nobelrestaurant sitzen der Gangsterboss Claude Corti (Philippe Caubére) und seine Männer um eine riesige Schale mit Austern und Meeresfrüchten, aus der sie sich gierig mit den Händen bedienen. Mehrere Flaschen Champagner und Schnaps stehen herum und lassen das gemeinsame Essen zum Gelage ausarten. Mittendrin greift einer von Cortis Untermännern eine Auster, riecht daran und sagt: „Wie eine ukrainische Nutte!“ Der ganze Tisch bricht in ein gröhlendes Gelächter aus …
Beilagenteller
Vergleiche aus der Welt der kulinarischen Genüsse sind immer beliebt. So lässt sich zum Beispiel mit einiger Berechtigung sagen: Ein Genre setzt sich zusammen wie eine Speisekarte. Es gibt die Appetizer, die erst so richtig Lust darauf machen, tiefer in die Materie einzusteigen, die Hauptgänge, die nicht nur in jeder Hinsicht satt machen, sondern mit gewagten Geschmackskombinationen herausfordern und die Sinne berauschen, und die Desserts, die der vorher geschaffenen Grundlage das Sahnehäubchen aufsetzen. Natürlich ist nicht jedes Gericht würdig, in einem Sternerestaurant serviert zu werden, aber manchmal verlangt der Appetit ja auch eher nach deftiger Hausmannskost, einfach und üppig. Bei den ersten beiden Filmen aus der neuen Reihe von e – m – s, „Der phantastische Film“, handelt es sich um genau solche: Zwei Titel, die am besten unter dem Begriff „Sättigungsbeilage“ einzusortieren sind.
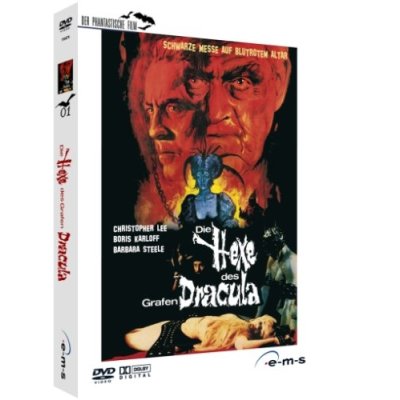 In „Die Hexe des Grafen Dracula“ folgt der Antiquitätenhändler Bob Manning, ein gutgelaunter 68er, der Spur seines verschollenen Bruders Peter zum Anwesen des mysteriösen Morley. Der streitet zwar ab, mit dem Bruder Kontakt gehabt zu haben, bietet Manning aber trotzdem großzügig Hilfe und Unterkunft an. Nachts peinigen Bob aber merkwürdige Träume, in denen eine Hexe vorkommt und ihn während eines Rituals zur Unterschrift eines Vertrages zwingt. Morley und sein Freund, der Okkultismus-Experte Professor Marsh, klären Manning auf: Bei der Hexe handelt es sich um Lavinia, eine Vorfahrin Morleys, die vor einigen hundert Jahren der Hexerei bezichtigt und verbrannt wurde. Einer der Ankläger war Jonathan Manning, seines Zeichens wiederum ein Vorfahre des Antiquitätenhändlers …
In „Die Hexe des Grafen Dracula“ folgt der Antiquitätenhändler Bob Manning, ein gutgelaunter 68er, der Spur seines verschollenen Bruders Peter zum Anwesen des mysteriösen Morley. Der streitet zwar ab, mit dem Bruder Kontakt gehabt zu haben, bietet Manning aber trotzdem großzügig Hilfe und Unterkunft an. Nachts peinigen Bob aber merkwürdige Träume, in denen eine Hexe vorkommt und ihn während eines Rituals zur Unterschrift eines Vertrages zwingt. Morley und sein Freund, der Okkultismus-Experte Professor Marsh, klären Manning auf: Bei der Hexe handelt es sich um Lavinia, eine Vorfahrin Morleys, die vor einigen hundert Jahren der Hexerei bezichtigt und verbrannt wurde. Einer der Ankläger war Jonathan Manning, seines Zeichens wiederum ein Vorfahre des Antiquitätenhändlers …
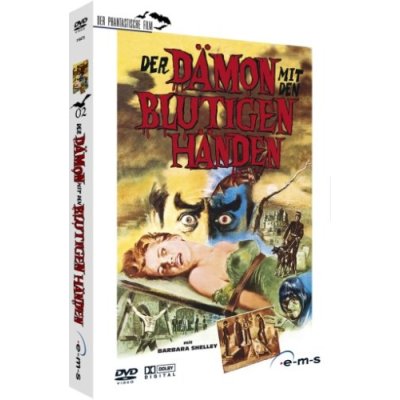 „Der Dämon mit den blutigen Händen“ beginnt in bester Grand-Guignol-Tradition mit der blutigen Pfählung eines Vampirs durch einen Kapuzen- und Vorschlaghammer-bewehrten Henker vor einem dunkel dräuenden (und unverkennbar gemalten) Himmel, bevor die Credits zu schriller Horrormusik durchs Bild laufen. Der britische Film aus dem Jahr 1958 erzählt im Folgenden die Geschichte des Arztes John Pierre, der aufgrund eines tödlich verlaufenen Bluttransfusions-Experiments zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Der Chef seines finsteren Gefängnisses, der von den anderen Häftlingen gefürchtete Callistratus, beruft ihn bald als Gehilfen in sein Labor: Auch Callistratus versucht, menschliches Blut von einem in den anderen Körper zu transportieren. Allerdings scheint er nicht nur rein wissenschaftliches Interesse am Gelingen seiner Experimente zu haben …
„Der Dämon mit den blutigen Händen“ beginnt in bester Grand-Guignol-Tradition mit der blutigen Pfählung eines Vampirs durch einen Kapuzen- und Vorschlaghammer-bewehrten Henker vor einem dunkel dräuenden (und unverkennbar gemalten) Himmel, bevor die Credits zu schriller Horrormusik durchs Bild laufen. Der britische Film aus dem Jahr 1958 erzählt im Folgenden die Geschichte des Arztes John Pierre, der aufgrund eines tödlich verlaufenen Bluttransfusions-Experiments zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Der Chef seines finsteren Gefängnisses, der von den anderen Häftlingen gefürchtete Callistratus, beruft ihn bald als Gehilfen in sein Labor: Auch Callistratus versucht, menschliches Blut von einem in den anderen Körper zu transportieren. Allerdings scheint er nicht nur rein wissenschaftliches Interesse am Gelingen seiner Experimente zu haben …
Beide Filme bemühen sich sichtlich, es dem großen Vorbild Hammer gleichzutun, scheitern aber letztlich daran. „Der Dämon mit den blutigen Händen“ von Henry Cass (nach einem Drehbuch von Hammer-Autor Jimmy Sangster) watet tief in saftigen Bildern des Gothic Horrors, garniert seine Settings mit Ratten, Bluthunden, entstellten Buckelmännern und Folterwerkzeugen und degradiert die Filme der auch schon nicht gerade zimperlichen Hammer Studios zu zahmem Kopfkino. Demgegenüber steht aber eine hölzerne Inszenierung und eine nur mäßig effektive Dramaturgie: Der Film verschenkt viel von seinem Potenzial, weil er im Mittelteil zu redundant wird, anstatt seine Handlung konsequent voranzutreiben. Ein ähnliches „Vergehen“ könnte man „Die Hexe des Grafen Dracula“ vorwerfen: Dem durchaus gelungenen Aufbau, der durch die Anwesenheit der Horror-Stars Christopher Lee, Boris Karloff, Michael Gough und Barbara Steele noch forciert wird, wird die unbefriedigende, ja unspektakuläre Auflösung leider niemals gerecht. Dass der Film auf H. P. Lovecrafts Geschichte „Träume im Hexenhaus“ beruhen soll, merkt man allerhöchstens an Details: den Traumbildern des satanischen Rituals, der Plotkonstruktion – die Konfrontation eines Mannes mit der Vergangenheit seiner Familie – oder den Farben (Schleimgrün und Lila), in die die Credits getaucht sind. Den unfassbaren Schrecken, den Lovecraft mit einer das Unbeschreibliche festzuhaltenden Sprache auf Papier zu bringen sucht, findet man in Sewells Film nicht.
Was beide Filme dennoch interessant macht, ist die Tatsache, dass beide ihre fantastische Prämisse nur als Täuschungsmanöver benutzen: Letzten Endes sind sowohl in „Der Dämon mit den blutigen Händen“ als auch in „Die Hexe des Grafen Dracula“ rein irdische Kräfte am Wirken, keine übersinnlichen. Das mag nicht ausreichen, um für beide Filme eine echte Empfehlung auszusprechen, der Genrefan wird mit ihnen aber durchaus den kleinen Hunger zwischendurch stillen können.
Die Hexe des Grafen Dracula
(Curse of the Crimson Altar, Großbritannien 1968)
Regie: Vernon Sewell, Drehbuch: Mervyn Haisman, Gerry Levin, Henry Lincoln, Kamera: John Coquillon, Musik: Peter Knight, Schnitt: Howard Lanning
Darsteller: Christopher Lee, Boris Karloff, Mark Eden, Barbara Steele, Michael Gough, Virginia Wetherell
Länge: 84 Minuten
Verleih: e – m – sDer Dämon mit den blutigen Händen
(Blood of the Vampire, Großbritannien 1958)
Regie: Herny Cass, Drehbuch: Jimmy Sangster, Kamera: Monty Berman, Musik: Stanley Black, Schnitt: Douglas Myers
Darsteller: Donald Wolfit, Vincent Ball, Barbara Shelley, Victor Maddem, William Devlin
Länge: 87 Minuten
Verleih: e – m – s
Zu den DVDs von e – m – s
Vol. 1 und Vol. 2 der neuen Reihe „Der phantastische Film“ kommen jeweils im Pappschuber. Was Ausstattung und Extras angeht, so hat „Die Hexe des Grafen Dracula“ aufgrund seines jüngeren Entstehungsdatums die Nase etwas vorn: Sind Bild und Ton bei „Der Dämon mit den blutigen Händen“ zwar absolut akzeptabel, aber dennoch etwas verwaschen, gibt es bei ersterem keinen Grund zur Klage. Zusätzlich zu den obligatorischen Bildergalerien und Texttafeln gibt es außerdem noch zwei verschiedene Super-8-Fassungen des Films, Trailer, Radio-Spots und einen alternativen Anfang. Für Sammler und Horrorfreunde sind beide Scheiben sicherlich ein Pflichtkauf.
Zur Ausstattung der DVDs:
Die Hexe des Grafen Dracula
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 1.0 Mono)
Extras: 2 Super-8-Fassungen, alternativer Anfang, Bildergalerien, Radiospots, Trailer, Booklet
Länge: ca. 84 Minuten
Freigabe: ab 16
Preis: 12,99 Euro
Der Dämon mit den blutigen Händen
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Digital 1.0 Mono)
Extras: Bildergalerie, Texttafeln, Booklet
Länge: ca. 87 Minuten
Freigabe: ab 16
Preis: 12,99 Euro
The Last of the Independents
Eine morgendliche Sommeridylle in New Mexico: Die Sonne kriecht hinter den Bergen hervor, Kinder spielen im Garten, bevölkern die langsam aus ihrem Schlaf erwachenden Straßen. Ein Auto fährt vor einer Kleinstadtbank vor, ein älterer Herr möchte einen Scheck einlösen. Ein Polizist tritt an das Auto, weist die Fahrerin, die Gattin des Mannes, freundlich darauf hin, dass sie im Halteverbot steht. Der ältere Herr zeigt seinen Gipsfuß, er wolle doch nur kurz in die Bank. Der Polizist lächelt und drückt ein Auge zu, der Mann steigt langsam aus dem Wagen. So beginnt Don Siegels Film: Mit einem krassen Bruch gegenüber dem düsteren Ende, das „Dirty Harry“ nur zwei Jahre zuvor genommen hatte. So scheint es jedenfalls zunächst. „The Last of the Independents“ weiterlesen
Filmische Entjungferung
Bilder der vor Hitze flirrenden Wüste, eine Stimme, die mit schwerstem southern drawl zu uns spricht: So endete „The Big Lebowski“, so beginnt „No Country for old Men“. Doch zwischen diesen beiden Filmen ist etwas passiert mit den Coens und mit dem Cowboy, dem diese Stimme gehört. Statt dem „Stranger“ (Sam Elliott), diesem fleischgewordenen Filmzitat, das den Zuschauer an die Hand nahm, gehört sie nun Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones), einem alternden Sheriff, der noch nie eine Waffe abgefeuert hat und sich nicht mehr heimisch fühlt in dieser Welt und Zeit. Es ist eben kein Land für alte Männer, sagt er nüchtern, man müsse flexibel sein, um in diesem Land zu überleben. Er wird mit dem Ausgang der Geschichte nichts zu tun haben, sich im Hintergrund halten – fast absichtlich kommt er immer einen Schritt zu spät. Doch es sind seine Augen, durch die wir auf dieses Land blicken und die uns immer auf Distanz zu den Bildern halten. „Filmische Entjungferung“ weiterlesen
Strähnen lügen nicht
15 Jahre, nachdem er unschuldig des Mordes an seiner Geliebten verurteilt wurde, kehrt der verbitterte Barbier Sweeney Todd (Johnny Depp) auf Rache sinnend ins London der Industrialisierung zurück. Objekt seines Hasses ist der verschlagene Richter Turpin (Alan Rickman), der sowohl für den Tod von Sweeneys Herzensdame als auch für das Komplott verantwortlich war, das zu dessen Inhaftierung führte. Auf der Suche nach Unterkunft trifft Sweeney die einsame Ms. Lovett (Helena Bonham-Carter), eine wenig talentierte Pastetenbäckerin, die den Barbier bei sich aufnimmt. Nachdem Sweeney von dem Konkurrenten Pirelli (Sacha Baron Cohen) als ehemaliger Mörder identifiziert und so zum ersten Mord getrieben wird, kommt ihm die Idee, wie er sich Turpins entledigen kann: Der Schurke soll als Füllung von Ms. Lovetts Pasteten enden. Bald schon stapeln sich die Leichen im Keller des Hauses und das Geschäft von Ms. Lovett floriert … „Strähnen lügen nicht“ weiterlesen
Des eigenen (Un)Glücks Schmied
Douglas Sirk, 1897 in Hamburg unter dem Namen Detlev Sierck als Sohn dänischer Eltern geboren, gilt als Meister des Melodrams. Ursula Vossen definiert es in ihrem Eintrag in „Reclams Sachlexikon des Films“ als „Spielfilmgenre, das auf triviale Handlung setzt, die Schicksalhaftigkeit des Lebens betont und den Zuschauer bis zur Gefühlsmanipulation emotional bewegt.“ Auf Sirks Filme trifft diese etwas abschätzig formulierte Definition jedoch nur bedingt zu. „Des eigenen (Un)Glücks Schmied“ weiterlesen
Vollstrecker des Kapitals
Ben Chamberlain (Henry Fonda), der Held wider Willen, und der Schurke Vince McKay (Michael Parks) stehen sich nach 90 Minuten zum unbewaffneten Duell gegenüber und taxieren sich mit ihren Blicken. Zuvor hatten McKay und seine Männer den Vagabunden durch die Prärie gehetzt – aus reiner Mordlust und weil sie ihm einen Mord in die Schuhe schieben wollten, den sie selbst begangen hatten. Nun sind McKays Männer tot und das Gesetz naht in Form eines einfahrenden Zuges. Das Duell wird nicht stattfinden. McKay erkennt seine Niederlage und wendet sich ab, Chamberlain rennt seinerseits der Famerswitwe Valverda Johnson (Anne Baxter) hinterher … „Vollstrecker des Kapitals“ weiterlesen
Mama, Papa, Zombie
Die heile Welt der Fünfzigerjahre: Der strahlende Ehemann kommt vom Karrieremachen ins fesche Eigenheim und wird an der Tür von seiner wunderschönen Ehe- und Hausfrau, die schon den ganzen Tag über am Herd gestanden hat, mit einem auf die Wange gehauchten Kuss empfangen. Der Sohn berichtet am Tisch von seinen hervorragenden Schulnoten und dann tritt der Hauszombie ein, um die Getränke zu servieren: In Andrew Curries „Fido – Gute Tote sind schwer zu finden“ ist das Grauen scheinbar perfekt in die Normalität integriert. „Mama, Papa, Zombie“ weiterlesen
Ein kurzer Film über das Töten
Nach dem Selbstverständnis eines seriösen Filmkritikers sieht die ideale und wohl einzig mögliche Kritik zu „John Rambo“ wie folgt aus: Nachdem man noch einmal pflichtbewusst-beschämt an den Erfolg der ersten drei „Rambo“-Filme in den Achtzigerjahren erinnert und Rambo/Stallone als ehemalige Leit- und jetzige Witzfigur der Reaganomics verhöhnt hat, geht man dazu über, Stallones ersten eigenen Regiebeitrag zum wohl berühmtesten Action-Franchise der Welt von der immer willkommenen ideologiekritischen Seite her abzukanzeln. Keine Polemik ist da zu billig: Stallone als Wahnsinnigen zu bezeichnen der Gipfel journalistischer Rechtschaffenheit. Zugegeben, „John Rambo“ bietet seinen schlangestehenden Kritikern reichlich Futter: Es dürfte schwierig werden, diesen Film in punkto Brutalität und Kompromisslosigkeit noch in den Schatten zu stellen, ohne dabei in filmische Grenzbereiche vorstoßen zu müssen.
Heim ins Reich
Der Journalist Blair Maynard (Michael Caine) reist mit seinem 12-jährigen Sohn Justin (Jeffrey Frank) in die Karibik, um dort für eine Story über das Bermuda-Dreieck zu recherchieren, wo Jahr für Jahr Schiffe unter mysteriösen Umständen verschwinden. Tatsächlich wird Maynard fündig: Bei einem Angelausflug fallen er und sein Sohn in die Hände von Piraten, die seit 300 Jahren unbemerkt auf einer kleinen Insel leben und sich mit dem über Wasser halten, was sie auf See erbeuten. Für Blair haben diese Piraten nun eine ganz besondere Aufgabe: Er soll den Fortbestand der Sippe sichern und mit der einzigen Frau ein Kind zeugen. Während Blair über einen Fluchtplan sinniert, unterzieht man seinen Sohn einer Gehirnwäsche … „Heim ins Reich“ weiterlesen
Godzilla oder wie die Japaner lernten, die Bombe zu lieben
Vor der japanischen Insel Oto verunglücken mehrere Fischerboote. Die abergläubische Bevölkerung glaubt an eine Rückkehr des Seeungeheuers Godzilla, das menschliche Opfer einfordert, sobald es durch menschlichen Raubbau an der Natur keine Nahrung mehr findet. Als das Monster die Insel betritt und eine Panik auslöst, beschließt auch die Regierung zu handeln. Sie evakuiert die Küstenregionen und stellt ein gewaltiges Armeeaufgebot, um dem Ungeheuer die Stirn zu bieten. Doch Godzilla lässt sich nicht aufhalten: In einer gewaltigen Zerstörungsorgie macht es Tokio dem Erdboden gleich, bis der Wissenschaftler Serizawa seine neueste Waffe zur Verfügung stellt … „Godzilla oder wie die Japaner lernten, die Bombe zu lieben“ weiterlesen
Froschperspektive
„Die Menschen müssen das sehen“, sagt Hud, der mit der Videokamera festhält, wie Manhattan von einem gigantischen Ungeheuer dem Erdboden gleichgemacht wird. Damit paraphrasiert er nicht nur das Versprechen der Marketingabteilung, die für die „Cloverfield“ -Kampagne alle Register gezogen hat, um die Menschen ins Kino zu locken, er knüpft auch unmittelbar an die Lesart ist, die nach „I am Legend“ nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr das größte amerikanische Trauma der Gegenwart zum Thema eines Genrefilms macht. Der Monsterfilm scheint sich für solche Allegorien besonders gut zu eignen. Frei nach dem Wortstamm „demonstrare“ begreift der Zuschauer das Monster automatisch als Zeichen für etwas anderes. Das funktionierte schon 1954 mit Inoshiro Hondas „Godzilla“, der personifizierten atomaren Bedrohung, der für „Cloverfield“ Pate stand. „Froschperspektive“ weiterlesen
Dialektik der Aufklärung
Der „Schulmädchen-Report“, eine zwischen 1970 und 1980 entstandene 13-teilige Filmserie, ist ein Phänomen: Mit minimalem Aufwand gedreht, entpuppte sie sich zum absoluten Publikumsmagneten und steht bis heute exemplarisch für den deutschen Softsex-Film der Siebzigerjahre. Basierend auf dem gleichnamigen Aufklärungsbuch von Günther Hunold, das im Zuge der Oswalt-Kolle-Welle erschien (aber durchaus zwiespältig rezipiert wurde), wurde „Schulmädchen-Report“ für rund 250.000 DM in nur wenigen Tagen produziert und erreichte sechs Millionen Zuschauer allein in der Bundesrepublik; wie die schleunigst nachgekurbelten Teile 2 und 3 erhielt er eine Goldene Leinwand. Insgesamt erreichten alle 13 Teile zusammen weltweit mehr als 100 Millionen Zuschauer und machten Hartwig zu einem der erfolgreichsten Filmproduzenten Deutschlands. „Dialektik der Aufklärung“ weiterlesen
Familientherapie
Die Ehre der Familie Gates steht auf dem Spiel: Vorfahre Thomas soll angeblich ein Kollaborateur des Präsidentenmörders Booth gewesen sein. Dies geht jedenfalls aus einer Tagebuchnotiz Booths hervor, die sich im Besitz des undurchschaubaren Mitch Wilkinson (Ed Harris) befindet. Ben Franklin Gates (Nicolas Cage) und sein Vater Patrick (Jon Voight) sind schockiert und setzen alles daran, den Ruf ihrer Familie wiederherzustellen. Dazu müssen wieder einmal diverse Codes geknackt, Puzzles gelöst, der Präsident entführt und das geheime Buch der Präsidenten, das die Antwort auf alle ungelösten nationalen Mysterien enthalten soll, gefunden werden. Die Spur führt die Schatzsucher schließlich zur sagenumwobenen Stadt Cibola, die die amerikanischen Ureinwohner einst aus purem Gold erbauten … „Familientherapie“ weiterlesen
Wenn der Nebel sich lichtet
Wie sehr sich die Ereignisse von 9/11 in die öffentlichen Diskurse eingeschrieben haben, wird nicht zuletzt an einem Film wie Frank Darabonts Der Nebel offenkundig, den man heute kaum noch anders als als Allegorie auf die Angst und Unsicherheit im Gefolge scheinbar irrationaler Terrorakte und die Erstarkung des religiösen Fanatismus in deren Gefolge betrachten kann. Dabei folgt diese Verfilmung einer Kurzgeschichte Stephen Kings von 1980 den Regeln eines fast vierzig Jahre alten Genres: des Katastrophenfilms. „Wenn der Nebel sich lichtet“ weiterlesen

