 Inhaltsangaben von Filmen sind manchmal Mittel, um Zuschauer unter falschen Vorwänden ins Kino zu locken. Dass die Handlung oftmals nicht sonderlich ausschlaggebend für die Qualität eines Filmes ist, stellt die französisch-belgische Giallo-Hommage Amer eindrucksvoll unter Beweis. Der Plot – eine Frau kehrt an den verwunschenen Ort ihrer Kindheit zurück – ist nicht nur denkbar dünn, sondern auch eine geradezu stereotype Kopie von Standardsituationen des Genres. Dass dem Regie-Duo Hélène Cattet und Bruno Forzani dennoch ein faszinierendes Werk gelingt, hat also mit diegetischen Elementen wenig zu tun.
Inhaltsangaben von Filmen sind manchmal Mittel, um Zuschauer unter falschen Vorwänden ins Kino zu locken. Dass die Handlung oftmals nicht sonderlich ausschlaggebend für die Qualität eines Filmes ist, stellt die französisch-belgische Giallo-Hommage Amer eindrucksvoll unter Beweis. Der Plot – eine Frau kehrt an den verwunschenen Ort ihrer Kindheit zurück – ist nicht nur denkbar dünn, sondern auch eine geradezu stereotype Kopie von Standardsituationen des Genres. Dass dem Regie-Duo Hélène Cattet und Bruno Forzani dennoch ein faszinierendes Werk gelingt, hat also mit diegetischen Elementen wenig zu tun.
„Hijacking the Viewer“ weiterlesen
Die dritte Supermacht
 Im Kalten Krieg waren die Fronten zwischen gut und böse, hüben und drüben, Freiheit und Unterdrückung usw. scheinbar klar. Ganz so klar allerdings doch nicht, wagte man einen dialektischen Blick auf das Beziehungsgeflecht zwischen den beiden Supermächten, bei dem sich dann die jeweilige Position einfach in ihr Gegenteil verkehrte. Die Friedensbewegung insistierte immer wieder besonders auf diese Übernahme der Gegenperspektive (als Sting etwa Ronald Reagan singend fragte, ob eine russische Mutter ihre Kinder etwa nicht liebe). Komplexität blieb aber weiterhin eher schädlich für ideologisch eindeutige Vermittlungen. Insofern ist die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Computer aus dieser Zeit auch ebenso von derartig vereindeutigenden Zugängen geprägt – hatte aber zumindest noch den Vorzug, dass die leicht nachvollziehbare Technophobie vor diesen Apparaten systemüberschreitend war und daher ganz neue, ungeahnte Koalitionen ermöglichte.
Im Kalten Krieg waren die Fronten zwischen gut und böse, hüben und drüben, Freiheit und Unterdrückung usw. scheinbar klar. Ganz so klar allerdings doch nicht, wagte man einen dialektischen Blick auf das Beziehungsgeflecht zwischen den beiden Supermächten, bei dem sich dann die jeweilige Position einfach in ihr Gegenteil verkehrte. Die Friedensbewegung insistierte immer wieder besonders auf diese Übernahme der Gegenperspektive (als Sting etwa Ronald Reagan singend fragte, ob eine russische Mutter ihre Kinder etwa nicht liebe). Komplexität blieb aber weiterhin eher schädlich für ideologisch eindeutige Vermittlungen. Insofern ist die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Computer aus dieser Zeit auch ebenso von derartig vereindeutigenden Zugängen geprägt – hatte aber zumindest noch den Vorzug, dass die leicht nachvollziehbare Technophobie vor diesen Apparaten systemüberschreitend war und daher ganz neue, ungeahnte Koalitionen ermöglichte.
Nehmen wir an, die Kuh ist eine Kugel
 … unter diesem zugegebenen zunächst absurd klingenden Titel erschien 1996 ein deutsches Taschenbuch, in dem Leser, die allenfalls über physikalische Schulkenntnisse verfügen, über die Welt der Physik aufgeklärt werden sollten. Im Titel – mag der Versuch nun geglückt sein oder nicht – offenbart sich jedoch bereits zweierlei: Die Physik, mit der wir es zu tun haben, muss auf ein denkbares Maß reduziert werden, damit wir sie handhaben können. Dazu bedarf es verschiedener „Vernachlässigungen“ (etwa oftmals der Reibung bei der Erforschung einfacher Bewegungsgesetze). Zum Anderen steht die Kuh-Kugel-Identifikation aber auch für einen Bildlichkeitszwang, dem die modernen Naturwissenschaften unterliegen und der sie zwar vermittelbar(er) macht, sie jedoch auch oft arg beschränkt. Nimmt man etwa die so genannten „neue Physik“ des ganz Großen oder des ganz Kleinen hinzu, sieht man schnell, wohin solche Ku(h)geln rollen.
… unter diesem zugegebenen zunächst absurd klingenden Titel erschien 1996 ein deutsches Taschenbuch, in dem Leser, die allenfalls über physikalische Schulkenntnisse verfügen, über die Welt der Physik aufgeklärt werden sollten. Im Titel – mag der Versuch nun geglückt sein oder nicht – offenbart sich jedoch bereits zweierlei: Die Physik, mit der wir es zu tun haben, muss auf ein denkbares Maß reduziert werden, damit wir sie handhaben können. Dazu bedarf es verschiedener „Vernachlässigungen“ (etwa oftmals der Reibung bei der Erforschung einfacher Bewegungsgesetze). Zum Anderen steht die Kuh-Kugel-Identifikation aber auch für einen Bildlichkeitszwang, dem die modernen Naturwissenschaften unterliegen und der sie zwar vermittelbar(er) macht, sie jedoch auch oft arg beschränkt. Nimmt man etwa die so genannten „neue Physik“ des ganz Großen oder des ganz Kleinen hinzu, sieht man schnell, wohin solche Ku(h)geln rollen.
„Nehmen wir an, die Kuh ist eine Kugel“ weiterlesen
Podcast: Play in new window | Download
The ultimate debugging is death.
 Technik macht Hoffnung und Technik macht Angst. Beides kommt am deutlichsten in Utopien zum Ausdruck, in denen die Zukunft der Menschheit vor dem Hintergrund technologischer Entwicklung verhandelt wird. Dass diese Utopien trotz all ihrer Fiktivität jedoch keineswegs immer fiktionalen Charakter haben müssen, zeigen Auseinandersetzungen von Platon bis in die Gegenwart. Gesellschaft und Technik entwickeln sich aneinander, befördern und behindern einander. Doch insbesondere seit der industriellen Revolution kippt das Bild immer markanter hin in Richtung der Dystopie: Die Technik beraubt den Menschen seiner Möglichkeiten anstatt ihn zu unterstützen, sie verursacht Isolation und Deprivation. Der Computer und seine technischen Apparaturen und Funktionen dienen seit einigen Jahrzehnten als Verkörperungsphantasma dieser Ängste. Der Deutsche Regisseur Jens Schanze widmet sich in seinem Dokumentarfilm „Plug & Pray“ genau diesem Phänomen.
Technik macht Hoffnung und Technik macht Angst. Beides kommt am deutlichsten in Utopien zum Ausdruck, in denen die Zukunft der Menschheit vor dem Hintergrund technologischer Entwicklung verhandelt wird. Dass diese Utopien trotz all ihrer Fiktivität jedoch keineswegs immer fiktionalen Charakter haben müssen, zeigen Auseinandersetzungen von Platon bis in die Gegenwart. Gesellschaft und Technik entwickeln sich aneinander, befördern und behindern einander. Doch insbesondere seit der industriellen Revolution kippt das Bild immer markanter hin in Richtung der Dystopie: Die Technik beraubt den Menschen seiner Möglichkeiten anstatt ihn zu unterstützen, sie verursacht Isolation und Deprivation. Der Computer und seine technischen Apparaturen und Funktionen dienen seit einigen Jahrzehnten als Verkörperungsphantasma dieser Ängste. Der Deutsche Regisseur Jens Schanze widmet sich in seinem Dokumentarfilm „Plug & Pray“ genau diesem Phänomen.
Didi: Geschichte einer Kunstfigur
 In der Bundesrepublik der 1980er Jahre kannte Didi Hallervorden jedes Kind. Mit dieser Kunstfigur hatte der zuvor vor allem als politischer Kabarettist auftretende Dieter Hallervorden ein Alter Ego erschaffen, das zum größten Erfolg seiner Karriere und ihm in gewisser Hinsicht auch zum Fluch wurde. Nach seinem Durchbruch in der Rolle des wild grimassierenden Anarcho-Clowns Didi, die im Verlauf der überaus erfolgreichen TV-Serie Nonstop Nonsens (1975-1980) herausgearbeitet wurde, war Hallervorden an diesen sehr klar definierten Rollentypus gebunden, und der zuvor auch durchaus in mehr oder minder seriösen Rollen überzeugende Charakterdarsteller, der sein Kinodebüt in Fritz Langs letztem Film Die 1000 Augen des Dr. Mabuse feierte und später mit Tom Toelle und Roman Polanski drehte, war auf ewig auf die Comedy festgelegt – bevor es so etwas wie Comedy in Deutschland überhaupt gab.
In der Bundesrepublik der 1980er Jahre kannte Didi Hallervorden jedes Kind. Mit dieser Kunstfigur hatte der zuvor vor allem als politischer Kabarettist auftretende Dieter Hallervorden ein Alter Ego erschaffen, das zum größten Erfolg seiner Karriere und ihm in gewisser Hinsicht auch zum Fluch wurde. Nach seinem Durchbruch in der Rolle des wild grimassierenden Anarcho-Clowns Didi, die im Verlauf der überaus erfolgreichen TV-Serie Nonstop Nonsens (1975-1980) herausgearbeitet wurde, war Hallervorden an diesen sehr klar definierten Rollentypus gebunden, und der zuvor auch durchaus in mehr oder minder seriösen Rollen überzeugende Charakterdarsteller, der sein Kinodebüt in Fritz Langs letztem Film Die 1000 Augen des Dr. Mabuse feierte und später mit Tom Toelle und Roman Polanski drehte, war auf ewig auf die Comedy festgelegt – bevor es so etwas wie Comedy in Deutschland überhaupt gab.
Die Politik der Zärtlichkeit
 Die „Jugend von heute“ stellt schon längst keinen Grund zur Aufregung mehr dar. Glaubt man den Berichten der Soziologen, dann träumt die Mehrzahl junger Abiturienten heute nicht mehr davon, sich aufzulehnen, etwas Verrücktes zu tun, die Welt zu bereisen oder gar zu verändern, mit möglichst vielen Menschen Sex zu haben oder Drogen zu nehmen. Stattdessen will sie eine „anständige“ Ausbildung absolvieren, studieren, Karriere machen und eine Familie gründen. Was würde sie wohl zu Jaromil Jires‘ „Valerie – Eine Woche voller Wunder“ , einem Loblied auf Jugend, freie Liebe, geistige Ausschweifung und Auflehnung gegen Autoritäten sagen? „Die Politik der Zärtlichkeit“ weiterlesen
Die „Jugend von heute“ stellt schon längst keinen Grund zur Aufregung mehr dar. Glaubt man den Berichten der Soziologen, dann träumt die Mehrzahl junger Abiturienten heute nicht mehr davon, sich aufzulehnen, etwas Verrücktes zu tun, die Welt zu bereisen oder gar zu verändern, mit möglichst vielen Menschen Sex zu haben oder Drogen zu nehmen. Stattdessen will sie eine „anständige“ Ausbildung absolvieren, studieren, Karriere machen und eine Familie gründen. Was würde sie wohl zu Jaromil Jires‘ „Valerie – Eine Woche voller Wunder“ , einem Loblied auf Jugend, freie Liebe, geistige Ausschweifung und Auflehnung gegen Autoritäten sagen? „Die Politik der Zärtlichkeit“ weiterlesen
Blutbad
Kamera: Maik Rauhmann
Piranha
(USA 2010)
Regie: Alexandre Aja; Buch: Pete Goldfinger, Josh Stolberg; Musik: Michael Wandmacher; Kamera: John R. Leonetti; Schnitt: Baxter
Darsteller: Richard Dreyfuss, Ving Rhames, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd, Eli Roth, Jerry O’Connell u.a.
Länge: 88 Minuten
Verleih: Kinowelt
Enter the Umbrella!
 In gewisser Weise haben die Bilder der Filme Paul W.S . Andersons schon immer versucht, den Zuschauer anzuspringen. Anderson ist, was ihm häufig zum Vorwurf gemacht wird, kein Geschichtenerzähler im herkömmlichen Sinne – er lässt seine Bilder für sich sprechen und findet er das passende Bild für einen Effekt, dann kann das ruhig auch einmal zu Lasten der Plotlogik oder sogar der mathematischen und physikalischen Gesetze gehen. In „Resident Evil – Afterlife“ wird dieses Erzählen zur grundsätzlichen Methode, bei der Anderson die 3D-Inszenierung entgegenkommt. Die Story wird zusehends nebensächlich und rekrutiert sich aus Versatzstücken bekannter Genrefilme.
In gewisser Weise haben die Bilder der Filme Paul W.S . Andersons schon immer versucht, den Zuschauer anzuspringen. Anderson ist, was ihm häufig zum Vorwurf gemacht wird, kein Geschichtenerzähler im herkömmlichen Sinne – er lässt seine Bilder für sich sprechen und findet er das passende Bild für einen Effekt, dann kann das ruhig auch einmal zu Lasten der Plotlogik oder sogar der mathematischen und physikalischen Gesetze gehen. In „Resident Evil – Afterlife“ wird dieses Erzählen zur grundsätzlichen Methode, bei der Anderson die 3D-Inszenierung entgegenkommt. Die Story wird zusehends nebensächlich und rekrutiert sich aus Versatzstücken bekannter Genrefilme.
»more a film about class in London«
Nachklapp zum kürzlich beendeten 24. Fantasy-Filmfest: Das Q&A mit Gerard Johnson über seinen Serienmörderfilm „Tony“:
Kamera: Maik Rauhmann
Als die Frauen noch Flügel hatten
 Ralph Bakshi gehört zu den ungewöhnlichsten Zeichentrickfilm-Regisseuren; insbesondere seine Filme für Erwachsene, „Fritz the Cat“ oder „Heavy Traffic“ haben ihm einen festen Platz im Pantheon der US-amerikanischen Popkultur gesichert. Mit seinen Fantasy-Stoffen „Lord of the Rings“ und „Fire and Ice“ setzte er tricktechnisch neue Maßstäbe und profilierte sich insbesondere gegen den Zeichentrick-Einheitsbrei aus den Disney-Studios. Sein postapokalyptischer Zeichentrickfilm „Wizards“ ist diesbezüglich ein „typischer Bakshi“, in dem sich viele Motive und Techniken der frühen und der späteren Arbeiten des Regisseurs finden. Jetzt ist der Film aus seiner relativen Vergessenheit herausgeholt und auf DVD und Blu-ray-Disc veröffentlicht worden.
Ralph Bakshi gehört zu den ungewöhnlichsten Zeichentrickfilm-Regisseuren; insbesondere seine Filme für Erwachsene, „Fritz the Cat“ oder „Heavy Traffic“ haben ihm einen festen Platz im Pantheon der US-amerikanischen Popkultur gesichert. Mit seinen Fantasy-Stoffen „Lord of the Rings“ und „Fire and Ice“ setzte er tricktechnisch neue Maßstäbe und profilierte sich insbesondere gegen den Zeichentrick-Einheitsbrei aus den Disney-Studios. Sein postapokalyptischer Zeichentrickfilm „Wizards“ ist diesbezüglich ein „typischer Bakshi“, in dem sich viele Motive und Techniken der frühen und der späteren Arbeiten des Regisseurs finden. Jetzt ist der Film aus seiner relativen Vergessenheit herausgeholt und auf DVD und Blu-ray-Disc veröffentlicht worden.
Zurückspulen oder Überspringen?
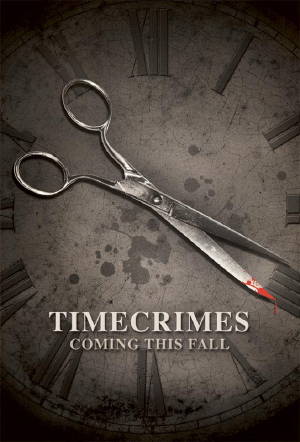 Zeitreisefilme gehören vielleicht zu den „selbstbewusstesten“ Filmen überhaupt, denn in ihnen wird nicht nur dem Unmöglichen ein Bild gegeben (und damit dem Spielfilm als Was-wäre-wenn-Medium vollständig entsprochen), sondern sie verhandeln auch stets das, was sie selbst sind: Produkte, die mit dem Fluss von Zeit operieren, verschiedene Zeitlichkeiten ins Bewusstsein rufen und miteinander in Konflikt führen. In eineinhalb Stunden können wir durch sie die Jahrtausende durchmessen oder einen einzigen Moment, eine Sekunde unendlich dehnen und damit in die Super- und Subbereiche der zeitlichen Wahrnehmung vordingen. Zeitreisefilme operieren auf der Demarkationslinie zwischen Alltagsphysik und Fantastik, wecken stets die intensivsten Spekulationen nicht nur über das „Was wäre wenn?“, sondern auch über das „Wie kann das sein?“. Und indem sie den Zuschauer beständig an die Aporien und Paradoxien seines eigenen Zeitbewusstseins erinnern, machen sie ihn manchmal sogar zu einem wichtigen „Handlungsträger“. Der ungemein intensive und erstaunlich spartanisch inszenierte Zeitreisefilm „Timecrimes“ des Spaniers Nacho Vigalondo ist gerade, was diesen letzten Punkt angeht, ein äußerst gerissener Vertreter seiner Art.
Zeitreisefilme gehören vielleicht zu den „selbstbewusstesten“ Filmen überhaupt, denn in ihnen wird nicht nur dem Unmöglichen ein Bild gegeben (und damit dem Spielfilm als Was-wäre-wenn-Medium vollständig entsprochen), sondern sie verhandeln auch stets das, was sie selbst sind: Produkte, die mit dem Fluss von Zeit operieren, verschiedene Zeitlichkeiten ins Bewusstsein rufen und miteinander in Konflikt führen. In eineinhalb Stunden können wir durch sie die Jahrtausende durchmessen oder einen einzigen Moment, eine Sekunde unendlich dehnen und damit in die Super- und Subbereiche der zeitlichen Wahrnehmung vordingen. Zeitreisefilme operieren auf der Demarkationslinie zwischen Alltagsphysik und Fantastik, wecken stets die intensivsten Spekulationen nicht nur über das „Was wäre wenn?“, sondern auch über das „Wie kann das sein?“. Und indem sie den Zuschauer beständig an die Aporien und Paradoxien seines eigenen Zeitbewusstseins erinnern, machen sie ihn manchmal sogar zu einem wichtigen „Handlungsträger“. Der ungemein intensive und erstaunlich spartanisch inszenierte Zeitreisefilm „Timecrimes“ des Spaniers Nacho Vigalondo ist gerade, was diesen letzten Punkt angeht, ein äußerst gerissener Vertreter seiner Art.
Der Film, der sich selbst spoilert.
The Silent House
(La Casa Muda, Uruguay 2010)
Regie: Gustavo Hernández; Buch: Oscar Estévez; Schnitt: Gustavo Hernández; Kamera: Pedro Luque
Darsteller: Gustavo Alonso, Florencia Colucci, Abel Tripaldi
Länge: 79 Minuten
Verleih: N. N.
Der Geist im Getriebe
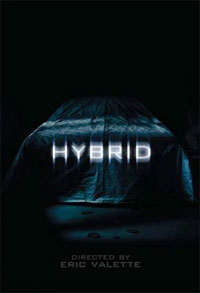 Das eigensinnige Auto zählt zu den vordersten Fetischobjekten des amerikanischen Traums. Das beginnt bereits in frühester Kindheit mit Walt Disneys „Love Bug“ Herbie, der das Auto als Wunschmaschine und den Automobilismus als Indoktrinationsstrategie prototypisch entwirft und vielleicht gar nicht zufällig im Jahr 1968 erstmalig über die Kinoleinwand raste. Einer aus der konservativen Sicht des Disney-Konzerns wohl zwangsläufig orientierungslos erscheinenden Jugend bot Herbie seinerzeit, ebenso wie wenige Jahre später in seiner etwas piefigeren bundesdeutschen Reinkarnation als postgelber „Käfer auf Extratour“ Dudu, jedenfalls eine überaus reizvolle Utopie an: Man muss überhaupt nicht wissen, wo man hin will: Wenn man nur im richtigen Auto sitzt, führt es einen schon an den zugemessenen Ort im Leben. Die passende Frau, der berufliche Erfolg, der Triumph des kleines Mannes im auf Mikroformat reduzierten Klassenkampf; die Geheimrezepte für all diese Mysterien liegen hinter dem Steuer, das man auch gern mal loslassen und sich einfach der Maschine überlassen darf. „Der Geist im Getriebe“ weiterlesen
Das eigensinnige Auto zählt zu den vordersten Fetischobjekten des amerikanischen Traums. Das beginnt bereits in frühester Kindheit mit Walt Disneys „Love Bug“ Herbie, der das Auto als Wunschmaschine und den Automobilismus als Indoktrinationsstrategie prototypisch entwirft und vielleicht gar nicht zufällig im Jahr 1968 erstmalig über die Kinoleinwand raste. Einer aus der konservativen Sicht des Disney-Konzerns wohl zwangsläufig orientierungslos erscheinenden Jugend bot Herbie seinerzeit, ebenso wie wenige Jahre später in seiner etwas piefigeren bundesdeutschen Reinkarnation als postgelber „Käfer auf Extratour“ Dudu, jedenfalls eine überaus reizvolle Utopie an: Man muss überhaupt nicht wissen, wo man hin will: Wenn man nur im richtigen Auto sitzt, führt es einen schon an den zugemessenen Ort im Leben. Die passende Frau, der berufliche Erfolg, der Triumph des kleines Mannes im auf Mikroformat reduzierten Klassenkampf; die Geheimrezepte für all diese Mysterien liegen hinter dem Steuer, das man auch gern mal loslassen und sich einfach der Maschine überlassen darf. „Der Geist im Getriebe“ weiterlesen
But what are we?
 Mexiko weist eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit auf. Entführungen zur Gelderpressung und Morde durch sich bekriegende Drogenbanden gehören zu den täglichen Nachrichten aus dem Land. Dass die dort vor allem in den Städten um sich greifende allgemeine Angst einen kulturellen Ausdruck im Horrorfilm finden würde, war nur eine Frage der Zeit; dass sich daraus allerdings ein Film wie „We are what we are“ entlädt, erscheint schon als Überraschung, denn die Gewalt und das Elend werden hier in einer ganz anderen Soziosphäre identifiziert, als man es erwarten würde: in der Familie.
Mexiko weist eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit auf. Entführungen zur Gelderpressung und Morde durch sich bekriegende Drogenbanden gehören zu den täglichen Nachrichten aus dem Land. Dass die dort vor allem in den Städten um sich greifende allgemeine Angst einen kulturellen Ausdruck im Horrorfilm finden würde, war nur eine Frage der Zeit; dass sich daraus allerdings ein Film wie „We are what we are“ entlädt, erscheint schon als Überraschung, denn die Gewalt und das Elend werden hier in einer ganz anderen Soziosphäre identifiziert, als man es erwarten würde: in der Familie.
Wutgeschoss
Tetsuo: The Bullet Man
(Jp 2009)
Regie & Buch: Shinya Tsukamoto; Musik: Chu Ishikawa; Kamera: Satoshi Hayashi, Takayuki Shida, Shinya Tsukamoto; Schnitt: Yuji Ambe, Shinya Tsukamoto
Darsteller: Eric Bossick, Akiko Monô, Yûko Nakamura, Stephen Sarrazin, Tiger Charlie Gerhardt, Prakhar Jain, Shinya Tsukamoto u.a.
Länge: 71 Minuten
Verleih: N. N.
Geist und Gehirn
Ghost Machine
(UK 2009)
Regie: Chris Hartwill; Buch: Sven Hugh, Malachi Smyth; Musik: Bill Grishaw; Kamera: George Richmond; Schnitt: Emma Gaffney, Dayn Williams
Darsteller: Sean Faris, Rachael Taylor, Luke Ford, Joshua Dallas, Halla Vilhjálmsdóttir, Sam Corry, Richard Dormer, Jonathan Harden
Länge: 89 Minuten
Verleih: n. n.
Der im VidCast erwähnte Essay zu Geistern aus dem Computer findet sich unter diesem Link.
Filmische Vernichtung
 Wie schwierig und gleichzeitig interessant es sein kann, filmisch das Nichts zu thematisieren, hatte Vincente Natali bereits 2003 in „Nothing“ gezeigt: Zwei Freunde stellen eines Morgens fest, dass die Welt um ihr Haus herum verschwunden ist und einer weißen Unendlichkeit Platz gemacht hat. Schon nach kurzer Zeit war für den Zuschauer klar: Dieses Nichts mag zwar ein dys- bzw. atopisches Setting sein, mehr jedoch ist es eine soziale Parabel, denn woran die beiden Freunde schließlich am meisten zu kauen haben, ist die mit dem Nichts einhergehende Isolation, die Ein- bzw. Ausgeschlossenheit aus der Mitwelt. Was dieses Thema angeht, macht Mark Fitzpatricks Film „The Nothing Men“ zwar nichts Neues, er holt das Thema jedoch zurück ins Reale.
Wie schwierig und gleichzeitig interessant es sein kann, filmisch das Nichts zu thematisieren, hatte Vincente Natali bereits 2003 in „Nothing“ gezeigt: Zwei Freunde stellen eines Morgens fest, dass die Welt um ihr Haus herum verschwunden ist und einer weißen Unendlichkeit Platz gemacht hat. Schon nach kurzer Zeit war für den Zuschauer klar: Dieses Nichts mag zwar ein dys- bzw. atopisches Setting sein, mehr jedoch ist es eine soziale Parabel, denn woran die beiden Freunde schließlich am meisten zu kauen haben, ist die mit dem Nichts einhergehende Isolation, die Ein- bzw. Ausgeschlossenheit aus der Mitwelt. Was dieses Thema angeht, macht Mark Fitzpatricks Film „The Nothing Men“ zwar nichts Neues, er holt das Thema jedoch zurück ins Reale.
The fearful Person
Kamera: Maik Rauhmann
Unsere Kritik zu „Enter the Void„
No Dirty Monks
Mann beißt Mann
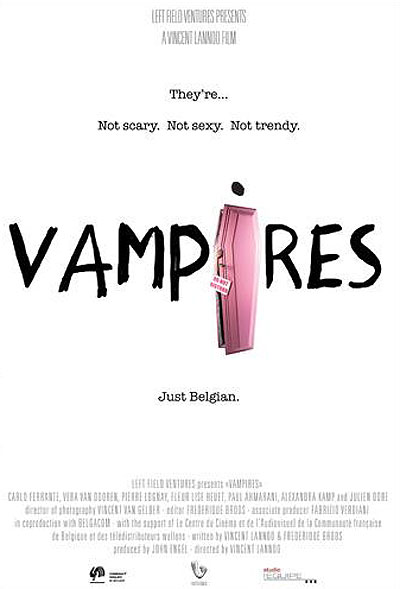 Die Renaissance des Vampir-Motivs in der derzeitigen Kulturproduktion ist schon erstaunlich – nicht zuletzt, weil man noch vor zehn Jahren annehmen durfte, dass das Subgenre eigentlich nichts Neues zu erzählen hat. Ein trefflicher Indikator für diese Diagnose schien einerseits in der quantitativ beachtliche Abwanderung in die Pornografie, andererseits die „dispositive Verdopplung“ des Vampirstoffes in Filmen wie „Shadow of the Vampire“ (2000) zu sein. Die neuerliche Wiederauferstehung der Vampire in Romanen und Filmen besitzt da hingegen schon fast den Charakter eines Backlashs, sind es doch wieder Liebesgeschichten und Melodramen, die in den Zentren der „Twilight“-Reihe und sogar von Filmen wie „So finster die Nacht“ (2008) stehen. Gerade letzterer hatte jedoch auch ein zweites Motiv des Vampirfilms erneut thematisiert: die soziale Frage des Miteinanders von Vampiren und Menschen. Während zuletzt „Daybreakers“ (2009) eine recht eindeutige Antwort auf diese gefunden hatte, schickt sich der Dokumentarfilm „Vampires“ nun an, das Thema von einer anderen Seite aus zu beleuchten.
Die Renaissance des Vampir-Motivs in der derzeitigen Kulturproduktion ist schon erstaunlich – nicht zuletzt, weil man noch vor zehn Jahren annehmen durfte, dass das Subgenre eigentlich nichts Neues zu erzählen hat. Ein trefflicher Indikator für diese Diagnose schien einerseits in der quantitativ beachtliche Abwanderung in die Pornografie, andererseits die „dispositive Verdopplung“ des Vampirstoffes in Filmen wie „Shadow of the Vampire“ (2000) zu sein. Die neuerliche Wiederauferstehung der Vampire in Romanen und Filmen besitzt da hingegen schon fast den Charakter eines Backlashs, sind es doch wieder Liebesgeschichten und Melodramen, die in den Zentren der „Twilight“-Reihe und sogar von Filmen wie „So finster die Nacht“ (2008) stehen. Gerade letzterer hatte jedoch auch ein zweites Motiv des Vampirfilms erneut thematisiert: die soziale Frage des Miteinanders von Vampiren und Menschen. Während zuletzt „Daybreakers“ (2009) eine recht eindeutige Antwort auf diese gefunden hatte, schickt sich der Dokumentarfilm „Vampires“ nun an, das Thema von einer anderen Seite aus zu beleuchten.
„Mann beißt Mann“ weiterlesen



