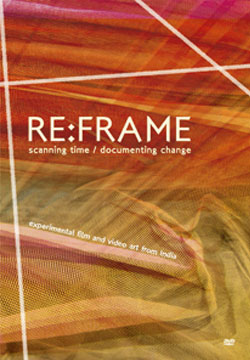 Eher unbekannt ist die Tatsache, dass Indien jährlich mehr Filme produziert als jedes andere Land der Welt. Noch weitaus unbekannter als der mittlerweile auch hierzulande florierende Mainstream des indischen Kinos sind jene Filme des Subkontinents, die abseits von Bollywood entstehen – so zum Beispiel die Kunst- und Autorenfilme des Parallel Cinema. Das Pariser Label Lowave bemüht sich nun mit seiner Kollektion Re:Frame – Scanning Time / Documenting Change, noch eine Schicht tiefer zu graben und ausgewählte indische Experimentalfilme vorzustellen.
Eher unbekannt ist die Tatsache, dass Indien jährlich mehr Filme produziert als jedes andere Land der Welt. Noch weitaus unbekannter als der mittlerweile auch hierzulande florierende Mainstream des indischen Kinos sind jene Filme des Subkontinents, die abseits von Bollywood entstehen – so zum Beispiel die Kunst- und Autorenfilme des Parallel Cinema. Das Pariser Label Lowave bemüht sich nun mit seiner Kollektion Re:Frame – Scanning Time / Documenting Change, noch eine Schicht tiefer zu graben und ausgewählte indische Experimentalfilme vorzustellen.
Experimentalfilme stellen zumeist nicht so sehr die narrativen Elemente, sondern die stilistischen Möglichkeiten des Films ins Zentrum – sie spielen mit den Ausdrucksformen, der Grammatik des Mediums und überzeugen dadurch oft eher auf formeller denn auf inhaltlicher Ebene. Dies trifft paradigmatisch auf Ashish Avikunthaks Endnote (2005) zu – den visuell beeindruckendsten Film dieser Sammlung. Endnote beginnt mit Sepia-farbenen, überbelichteten Bildern, die aussehen als seien sie eine Mischung aus Negativen und Aufnahmen einer Infrarot-Kamera. Diese mehrfach wiederkehrenden Stilisierungen lassen die Repräsentationen der abgefilmten Umwelt fast zu Abstraktionen werden.
In anderen Szenen arbeitet Avikunthak mit intensiv-übersättigten Farben und Unschärfen, die gemeinsam eine surreal-träumerische Wirkung erzielen. Zudem setzt er wiederholt Zeitmanipulationen ein: Mal beschleunigt er die Bilder extrem, um sie wenig später ebenso stark zu verlangsamen und die Zeit nahezu still stehen zu lassen. Die Tonspur mit ihren oftmals dissonanten Musik-Einspielungen und dem hypnotischen Gesang der Protagonistinnen sorgt für weitere Verfremdung. Doch zwischen diesen rätselhaften Sequenzen stehen als Kontrast ganz realistische, ja dokumentarische Bilder – einzig die Dialoge, einem Stück Samuel Becketts (Come and Go) entnommen, verleihen dem Film an diesen Stellen noch die ansonsten vorherrschende Atmosphäre der Entrückung. Es ist eine Entrückung aus dem Präsens in die Zeit der Kindheit. Drei junge Frauen erinnern sich an gemeinsame Hüpfspiele, an ihre Mädchenfreundschaft aus vergangenen Tagen. Doch gerade ihr Versuch des Re-Enactment, der Zurückversetzung in jene Zeit, verdeutlicht ihnen die Unerreichbarkeit, den irreversiblen Verlust der eigenen Jugend. Das Tuscheln übereinander verrät die Trennlinien – die Barrieren der Subjektivität und Individualität, welche sich zwischen den einstmals symbiotischen, nun jedoch erwachsen gewordenen Frauen aufgebaut haben. Stil und Inhalt korrespondieren hier geschickt miteinander – die experimentellen Bild-Verfremdungen symbolisieren die Entfremdung der Figuren. Die Erinnerungen können nicht wieder real werden, weshalb sie der Film konsequent in surrealer Form darstellt.
Eher Dokumentation als Experimentalfilm – und daher auch eindeutig auf sein Thema statt den Stil fokussiert – ist I love my India (2003) von Tejal Shah, der inhaltlich stärkste Film der Kollektion. Shah lässt Jahrmarkts-Besucher mit Luftgewehren auf ein Brett voller Ballons schießen, die zusammen den Slogan „I love my India“ bilden – ein patriotisches Motto aus den 90er-Jahren. Diesem Frontalangriff auf den indischen Nationalismus gesellt sich eine subtilere Provokation hinzu, wenn Shah die Teilnehmer mit Fragen zum Zustand der indischen Demokratie konfrontiert und den aus ihren Antworten sprechenden Nationalismus hinterfragt. Anders als die mit ähnlichen rhetorischen Entlarvungs-Techniken arbeitenden Filme Michael Moores oder Sacha Baron Cohens meint es I love my India dabei jederzeit vollkommen ernst. Die Umfrage unter den Durchschnitts-Menschen auf der Straße führt nämlich zu dem erschreckenden Ergebnis, dass die Befragten unter dem Vorwand des Patriotismus und der staatsbürgerlichen Loyalität eklatante Defizite der indischen Demokratie gezielt ignorieren, ethnisch-religiöse Grabenkämpfe beschönigen und selbst von jüngeren Pogromen gegen Minderheiten nichts wissen oder wissen wollen. Shah fragt die Menschen immer wieder nach dem Massaker von Gujarat, bei dem im Jahr 2002 über 1000 Menschen ums Leben kamen, weil der Staat nicht einschritt, als aufgebrachte Hindus mit ihnen verfeindete Moslems angriffen. Dass sich das indische Volk immer wieder selbst bekämpft, legt Shah auch mit der Art ihrer Montage nahe, wenn die Einstellungen so geschnitten werden, dass es aussieht, als würden die Luftgewehrschützen aufeinander schießen. Es sind jedoch weniger die zahlreichen Konfliktlinien der indischen Nation, welche die Regisseurin anprangert, sondern die absichtliche Blindheit der Bürger und deren Weigerung, die Probleme der indischen Politik überhaupt anzuerkennen. „Etwas nicht zu sehen ist ebenso ein politischer Akt wie etwas zu sehen“, heißt es dazu einmal in diesem klugen Film.
Space Bar (2008) von Debkamal Ganguly ist wiederum ein Film, der stilistische Innovationen gegenüber inhaltlicher Aussagekraft priorisiert. Vordergründig erzählt der Film eine Geschichte über den Gegensatz von Stadt und Land – ein Gegensatz, der sich seit Erfindung der (hier oft gezeigten) Eisenbahn und dem Einsetzen von Urbanisierungs-Prozessen teils aufgelöst, teils aber auch verstärkt hat. Im Kern aber ist Space Bar ein Werk, das begreiflich macht, warum man den Film früher auch ‚Lichtspiel‘ nannte. Das Erste was wir sehen, ist einfach nur ein Lichtstrahl, der das Dunkel erhellt – so wie dieser Film beginnt, so begann einst die gesamte Geschichte des Films. Kurz darauf fährt ein Mann mit seinem Finger über den Bildschirm seines Laptops – dort, wo sein Finger aufdrückt, verändert sich das Licht, dort, wo sein Finger war, bilden sich Schlieren, durch die das Licht anders scheint als auf dem Rest des Bildschirms. Später werden Bilder auf nackte Menschen projiziert, werden Körper als Leinwände genutzt, nehmen Rücken das Licht der Projektoren auf. Google Maps zeichnet seine Landschaftsaufnahmen auf die Landschaften des menschlichen Körpers.
Ein einzelnes Körperteil, die Hand, taucht immer wieder im Film auf – losgelöst vom restlichen Körper. Es sind Hände, die mit dem Licht spielen, nach ihm greifen und es doch nicht fassen können – das Licht ist es ja schließlich, das erst die Illusions-Kraft des Films ermöglicht, das uns die Repräsentation mit dem Repräsentierten verwechseln lässt (wie wenn in Godards Les Carabiniers ein Junge die Leinwand stürmt, weil er eine badende Frau berühren will – die aber eben nur als Repräsentation in diesem Raum existiert, als abwesende Anwesenheit). Über das Licht setzt Ganguly auch den Gegensatz von Stadt und Land ins Bild: In der Stadt scheint das Licht immer aus Computern, Straßenlampen oder Autos, künstlichen Lichtquellen also – während auf dem Land nur das natürliche Licht der Sonne vorkommt. Space Bar lässt sich durch diesen Antagonismus jedoch nicht zu einer naiven Idealisierung des einfachen Landlebens gegenüber dem hektischen Leben in der Stadt hinreißen. Um eine konkrete Aussage geht es diesem atemlosen, kaum einmal verweilenden, sondern ständig umher springenden Film auch gar nicht. Der rätselhafte, aus verschiedenen literarischen Quellen stammende Voice-Over-Kommentar , verdeutlicht dies akustisch, wenn er sich von den Bildern löst statt sie zu erklären, zu deuten, für seine Zwecke zu nutzen. Hier soll keine Urbanisierungs-These propagiert oder widerlegt werden – hier werden ebenso schlicht wie schön die künstlerischen Möglichkeiten des Films ausgelotet, die Wirkungen von Licht und Ton, Bild und Sprache.
Ein weiteres zentrales Element des Mediums Film – die Bewegung – entdecken wir in Sarnath Banerjees Beitrag Bengali Tourist (2003). Der vierminütige Film gibt die Berichte eines Marokkaners wieder, der im 14. Jahrhundert nach Bengalen kam und am Ende seiner zahlreichen Reisen resümierte, dass seine Erfahrungen in anderen Ländern die beste Begründung seien, um in der Heimat zu bleiben, da es überall anders schlechter wäre. Ergänzt wird diese Feststellung des über die Fremde nörgelnden Reisenden, dass es nirgendwo so schön sei wie zu Hause, durch die Beobachtung eines jungen Bengalen, der Reisen insgesamt für sinnlos hält, da sich dabei stets nur der Körper bewege, die Gedanken aber zu Hause verweilten. Bedeutsam ist an Banerjees Film jedoch nicht etwa diese durchaus amüsante Anekdote, sondern das Kunststück, in die Standbilder – aus denen der gesamte Film besteht – Leben und Bewegung zu bringen. Dies gelingt dem Regisseur einerseits durch Kamerafahrten über und Zooms in die ansonsten komplett statischen Photographien – andererseits vitalisiert Banerjee die Bildfläche auch durch Animationen, die er den Photos hinzufügt und somit zwei disparate und dennoch komplementäre Bildebenen schafft.
Die restlichen drei Filme vereint der Blick in die Vergangenheit: Pushpamala N verbindet im Look des Stummfilms (schwarz-weiße Bilder, Zwischentitel, Masken über der Linse) die nationale Geschichte Indiens mit der privaten Geschichte einer imaginären Familie. Auf recht klischeehafte Weise kontrastiert ihr Film National Pudding & Indigenous Salad (2004) ‚ typisch männliche‘ und ‚typisch weibliche‘ Eigenschaften und Prioritäten: Der Vater denkt an den Krieg, die Mutter ans Kochen, er repräsentiert Disziplin und Ordnung, sie hingegen Emotionalität und Fürsorge. Der gemeinsame Sohn steht noch zwischen den Beiden, wird aber von der Schule zum Nachfolger seines Vaters, zum patriotischen Staatsbürger erzogen. Am Ende isst die Familie die beiden Titel-gebenden Gerichte, die mit der Nationalflagge dekoriert sind. Da die Bilder des Films explizit auf die 50er-Jahre rekurrieren, lässt sich der dargestellte Nationalstolz hier – anders als in I love my India – als positives Gefühl, ja als historische Notwendigkeit für den 1947 mit der Staatsgründung abgeschlossenen Unabhängigkeitskampf des indischen Volkes erkennen.
Ayisha Abrahams Bilder aus Straight 8 (2005) sind zwar größtenteils bunt, stammen aber ebenfalls aus der Frühphase des modernen indischen Staates. Ihr Werk portraitiert einen Amateurfilmer, der mit seiner Super8-Kamera (daher der Titel) und einigen enthusiastischen Freunden internationale Kino-Filme nachstellte. Seine gealterten Bilder weisen Risse, Kratzer und Flecken auf – und doch gelingt es diesen naiven Privat-Aufnahmen, nebenbei ein Stück subjektiver Geschichtserfahrung zu dokumentieren, die Chronik des jungen indischen Staates aus individueller Perspektive zu schildern. Insofern ist Abrahams Arbeit eine bewusste Dokumentation der unbewussten Dokumentationen eines frühen indischen Amateurfilmers.
Historisch orientiert arbeitet auch das aus Neu Delhi stammende Raqs Media Collective, wenn es in Ceasural, Variations 1 and 2 (2007) eine Stahl-Fabrik aus dem amerikanischen Pittsburgh zeigt, also in die Blütezeit der zweitgrößten Stadt Pennsylvanias blickt. Alte Photographien der Fabrik werden als Standbilder genutzt und mit darüber gelegten Störeffekten verfremdet – ein schleifenartiger, bemüht poetischer Voice-Over-Kommentar begleitet die Bilder, weist aber kaum inhaltliche Konvergenzen mit ihnen auf. Im ersten Teil des Werks (Variation 1) sehen wir bewegte Bilder des heutigen Pittsburgh – in einer Art vertikalem Diptychon, einem Split Screen mit je zwei simultanen Einstellungen, erweist sich der Fabrik-Rauch als Konstante in der Arbeiterstadt Pittsburgh. Das verbliebene Bildfenster zeigt abwechselnd Wasser, ein Haus, den Himmel, einen Wald. Ein Großteil der verfügbaren Bildfläche hingegen bleibt komplett schwarz, auch die Tonspur ist leer. Diese Arbeit wirkt wie eine museale Video-Installation, die ihren Gegenstand über die einzelnen Teile seiner Summe zu erschließen versucht. Da es sich bei diesem Gegenstand um eine amerikanische Stadt handelt und der Film auch sonst nicht als ‚indisch‘ zu erkennen ist, sticht dieser Beitrag ein wenig unpassend aus der Kollektion heraus.
Das große Filmland Indien steht sechs Jahrzehnte nach seiner Unabhängigkeitserklärung immensen sozialen und politischen Herausforderungen gegenüber. Von außen drohen der militärische Feind Pakistan und der wirtschaftliche Konkurrent China, während Indien über die West-Anbindung seine eigene Machtposition zu stärken versucht. Innen muss der Staat gegen Armut, ethnische und religiöse Spaltungen sowie den maoistischen Terrorismus kämpfen. Es erstaunt daher nicht, dass viele der auf Re:Frame versammelten Filme nicht nur ein künstlerischer Anspruch, sondern auch eine historische Dimension, mitunter auch politisches Engagement kennzeichnet. In den sieben Filmen scheint also nicht nur das experimentelle Spiel mit medialen Ausdrucksmöglichkeiten, sondern fast immer auch ein dokumentarischer Gestus auf. Das soziopolitische Indien findet sich notwendigerweise im filmischen Indien wieder.
Re:Frame – Scanning Time / Documenting Change. Experimental Film and Video Art from India
(Indien 2003-2008(
RegisseurInnen: Ayisha Abraham, Ashish Avikunthak, Sarnath Banerjee, Debkamal Ganguly, Pushpamala N, Tejal Shah, Raqs Media Collective
Länge: 88 Min. (Extras: 20 Min.)
Verleih: lowave
Extras: Interviews, KünstlerInnen-Portraits, Texte zu den Filmen
Bild: 4:3
Ton: Hindi, Englisch, indische Dialekte
Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch
Freigabe: keine Angabe
Preis: 25,00 Euro

