 „Wer am lautesten schreit, hat Unrecht.“: ein typischer Elternsatz, den wahrscheinlich jedes Kind irgendwann einmal zu hören bekommen hat und der ohne Frage einen wahren Kern enthält – Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Wirft man aber einen Blick in E-Mails, Forenbeiträge oder Blogkommentare, kommt man kaum umhin, anzunehmen, dass sich diese Erkenntnis ins Gegenteil verkehrt hat: Nicht die Qualität der Argumente zählt, sondern die Zahl der verwendeten Ausrufezeichen, Großbuchstaben und Beleidigungen. Was das mit „Ong-Bak 3“ zu tun hat? Auch ihm liegt der Irrglaube zugrunde, dass inhaltliche Mängel durch formalen Überfluss ausgeglichen würden, dass sich die gewünschten Emotionen beim Zuschauer schon einstellten, wenn man ihn nur beharrlich genug bedrängt und anschreit. „Ong-Bak 3“ ist das filmische Äquivalent zur Caps-Lock-E-Mail.
„Wer am lautesten schreit, hat Unrecht.“: ein typischer Elternsatz, den wahrscheinlich jedes Kind irgendwann einmal zu hören bekommen hat und der ohne Frage einen wahren Kern enthält – Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Wirft man aber einen Blick in E-Mails, Forenbeiträge oder Blogkommentare, kommt man kaum umhin, anzunehmen, dass sich diese Erkenntnis ins Gegenteil verkehrt hat: Nicht die Qualität der Argumente zählt, sondern die Zahl der verwendeten Ausrufezeichen, Großbuchstaben und Beleidigungen. Was das mit „Ong-Bak 3“ zu tun hat? Auch ihm liegt der Irrglaube zugrunde, dass inhaltliche Mängel durch formalen Überfluss ausgeglichen würden, dass sich die gewünschten Emotionen beim Zuschauer schon einstellten, wenn man ihn nur beharrlich genug bedrängt und anschreit. „Ong-Bak 3“ ist das filmische Äquivalent zur Caps-Lock-E-Mail.
Verkehrte Comicwelt
 Das auf der Grundlage lizenzierter Vorlagen aus dem weiten Feld der Populärkultur programmierte Videospiel genießt nicht unbedingt den besten Ruf: Mit der heißen Nadel angesichts einer per Crosspromotion festgelegten Deadline gestrickt, scheinen seine meist an aktuellen Kinoveröffentlichungen ausgerichteten Exempel allzu oft nicht so recht zu Ende gedacht, scheint das Spieldesign dahin geschludert oder die Technik unperfekt. Auch die beiden Comicsuperhelden Batman und Spider-Man litten schon in schöner Regelmäßigkeit unter diesen Mängeln in nahezu unzähligen Videospielinkarnationen, die ihre diversen, mehr oder minder avancierten Kinoauftritte eskortierten – von Burton über Schumacher bis Nolan auf der einen, von Raimi über Raimi bis Raimi auf der anderen Seite.
Das auf der Grundlage lizenzierter Vorlagen aus dem weiten Feld der Populärkultur programmierte Videospiel genießt nicht unbedingt den besten Ruf: Mit der heißen Nadel angesichts einer per Crosspromotion festgelegten Deadline gestrickt, scheinen seine meist an aktuellen Kinoveröffentlichungen ausgerichteten Exempel allzu oft nicht so recht zu Ende gedacht, scheint das Spieldesign dahin geschludert oder die Technik unperfekt. Auch die beiden Comicsuperhelden Batman und Spider-Man litten schon in schöner Regelmäßigkeit unter diesen Mängeln in nahezu unzähligen Videospielinkarnationen, die ihre diversen, mehr oder minder avancierten Kinoauftritte eskortierten – von Burton über Schumacher bis Nolan auf der einen, von Raimi über Raimi bis Raimi auf der anderen Seite.
»Auf unserem Planeten sind wir die Predators.«
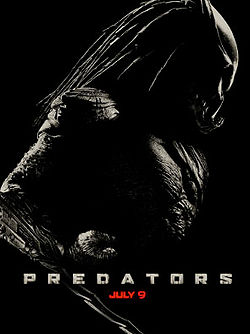 Florian Reinacher, Jörg Buttgereit und Stefan Höltgen haben sich die deutschsprachige Pressevorführung von Nimród Antals Film „Predators“ angesehen, der am 8. Juli in den deutschen Kinos anläuft. „Predators“ stellt eine Fortsetzung des 1987 von John McTiernans gedrehten „Predator“ dar und versetzt seine Figuren auf einen fernen Planeten, wo sie zum Jagdwild dreier Predator-Aliens werden. Die aus gar nicht so unterschiedlichen Figuren (Killer, Schwerverbrecher, Söldner, …) bestehende Gruppe muss zunächst zusammenfinden, um der Gefahr Herr zu werden und überhaupt herauszufinden, wo sie sich eigentlich befindet. Im Verlauf des Films wird die Gruppe zusehends dezimiert, so dass sich alles auf ein Zusammentreffen der von Beginn an ausgemachten Hauptfiguren mit dem Monstern zuspitzt. „Predators“ ist mit diesem Konzept, insbesondere aber aufgrund seiner Besetzung auf ganz geteilte Meinungen bei den Podcastern gestoßen.
Florian Reinacher, Jörg Buttgereit und Stefan Höltgen haben sich die deutschsprachige Pressevorführung von Nimród Antals Film „Predators“ angesehen, der am 8. Juli in den deutschen Kinos anläuft. „Predators“ stellt eine Fortsetzung des 1987 von John McTiernans gedrehten „Predator“ dar und versetzt seine Figuren auf einen fernen Planeten, wo sie zum Jagdwild dreier Predator-Aliens werden. Die aus gar nicht so unterschiedlichen Figuren (Killer, Schwerverbrecher, Söldner, …) bestehende Gruppe muss zunächst zusammenfinden, um der Gefahr Herr zu werden und überhaupt herauszufinden, wo sie sich eigentlich befindet. Im Verlauf des Films wird die Gruppe zusehends dezimiert, so dass sich alles auf ein Zusammentreffen der von Beginn an ausgemachten Hauptfiguren mit dem Monstern zuspitzt. „Predators“ ist mit diesem Konzept, insbesondere aber aufgrund seiner Besetzung auf ganz geteilte Meinungen bei den Podcastern gestoßen.
Predators
(USA 2010)
Regie: Nimród Antal; Buch: Alex Litvak, Michael Finch; Musik: John Debney; Kamera: Gyula Pados; Schnitt: Dan Zimmerman
Darsteller: Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins, Oleg Taktarov, Laurence Fishburne, Danny Trejo, Louis Ozawa Changchien, Mahershalalhashbaz Ali u. a.
Verleih: 20th Century Fox
Länge: 107 Minuten
Start: 8.7.2010
Steven Seagal. Hard to Kill, oder: Die Würde des alternden Actionhelden
 „Das Kino ist eine dramatische Kunst; die Welt organisiert sich hier Kräften gemäß, die in Konfrontation stehen; alles hier ist Duell und Konflikt; aber ohne jeden Zweifel findet es seine Erfüllung in seiner eigenen Negation: in der Kontemplation“, schreibt Jacques Rivette, und das nach schier endloser Zeit der Irrelevanz seit einigen Jahren wieder quicklebendige amerikanische B-Movie funktioniert vielleicht vor allem deshalb so hervorragend, weil seine alternden Heroen erkannt haben, dass in den Genres der cineastischen Bewegungspoesie mehr Bewegung nicht zwangsläufig auch mehr Poesie bedeutet.
„Das Kino ist eine dramatische Kunst; die Welt organisiert sich hier Kräften gemäß, die in Konfrontation stehen; alles hier ist Duell und Konflikt; aber ohne jeden Zweifel findet es seine Erfüllung in seiner eigenen Negation: in der Kontemplation“, schreibt Jacques Rivette, und das nach schier endloser Zeit der Irrelevanz seit einigen Jahren wieder quicklebendige amerikanische B-Movie funktioniert vielleicht vor allem deshalb so hervorragend, weil seine alternden Heroen erkannt haben, dass in den Genres der cineastischen Bewegungspoesie mehr Bewegung nicht zwangsläufig auch mehr Poesie bedeutet.
„Steven Seagal. Hard to Kill, oder: Die Würde des alternden Actionhelden“ weiterlesen
Schattenmänner
Eine Frau im Dunkel ihrer nächtlichen Wohnung. Sie weiß, dass sie nicht allein ist. Plötzlich löst sich eine Gestalt aus dem Schatten, nur um im nächsten Sekundenbruchteil wieder in der Dunkelheit abzutauchen, so als verfüge sie nicht über Materie, als sei sie selbst nur ein Schatten. Es ist ein Ninja, ein schwarz gewandeter japanischer Profikiller und Meister des lautlosen Tötens. Nicht nur verfügt er über eine erstaunliche Körperbeherrschung und ein beachtliches Waffenarsenal, seine Fähigkeiten grenzen an Magie. Aber wie besiegt man jemanden, der nicht nur in der Lage ist, sich buchstäblich in Luft aufzulösen, sondern darüber hinaus selbst ein Experte im Töten ist? „Schattenmänner“ weiterlesen
Gefühle sind ein verdammter Luxus
Um panache geht es in diesem Film: jene Tugend kompromissloser Tapferkeit vor dem Feind, jener eiskalte und schnörkellose Professionalismus, der den harten Jungs irgendwann einmal – wohl mit dem Verlust des Gangsterethos – verloren gegangen ist. Man muss nicht zuerst schießen, man muss lediglich zuerst treffen, das wusste bereits William Munny in Clint Eastwoods epochalem Spätwestern „Unforgiven“. So wie dieser ist auch Jesse V. Johnsons „The Butcher“ ein Film der alten Männer, aber statt Zynismus und Bitterkeit herrschen hier Wärme und Wehmut vor. Die melancholische Färbung der Erzählung etabliert bereits in den ersten Sekunden des Films der große, tragische Mime Michael Ironside mit einem Monolog über die guten alten Zeiten und die harten Jungs, die heute einfach nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Ironside ist nur in diesem Film, um diese wenigen Sätze zu sprechen, und sie bestimmen den Tonfall für alles Folgende.
 Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.
Jesse V. Johnson, der in den letzten Jahren bereits mit einigen ungewöhnlichen Arbeiten aus der Masse der Low-Budget-Actionregisseure herausstach, erzählt in seinem bisher ambitioniertesten Werk die Geschichte des alternden Mobsters Merle „Butcher“ Hench (Eric Roberts), einem ehemaligen Preisboxer, der nach seiner Karriere zum Handlanger in einer mafiösen Organisation geworden ist, dort aber nie über den Status als kleiner Gauner hinausgekommen ist und nun „einen Drink einem Kampf vorzieht“, wie es im einführenden Off-Kommentar des Prologs über ihn heißt. Merle sieht dem Herbst seines Lebens und seiner kriminellen Karriere entgegen, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass ihm im Grunde niemand wirklich Achtung entgegenbringt. Sein Boss Murdoch (Robert Davi) rät ihm zum vorzeitigen Ruhestand, weil er einen jungen Gangster, der ihm wiederholt Schwierigkeiten bereitet hat, mit warnenden Worten davonkommen lässt, statt ihn dem Jobprofil entsprechend kaltblütig hinzurichten, und sein Rivale Eddie lockt ihn gar in eine Falle, um ihn zunächst zu ermorden und ihm dann den Raub von knapp 5 Millionen Dollar Mafiageld in die Schuhe zu schieben. Doch Merle mag nicht zu den ehrgeizigsten oder brutalsten Jungs im Syndikat zu gehören – ein kühl kalkulierender Professional ist er in jedem Fall. Somit stellt sich Merle gegen den als Vaterfigur fungierenden Murdoch und macht sich mit der Kellnerin Jackie (Irina Björklund) auf den Weg in ein neues Leben – oder doch zumindest auf einen letzten großen Rachefeldzug zur Wiedererringung seiner lang verlorenen Würde.
Die Art und Weise, wie Regisseur Johnson und Hauptdarsteller Roberts diesen Merle Hench zeichnen, als nicht aus Neigung oder Selbstzweck brutalen, aber im Angesicht seiner Gegner absolut kaltblütigen Profi und dennoch gutmütigen, duldsamen und von einem langen Leben auf der falschen Seite des Gesetzes gezeichneten Mann, ist schlichtweg eindrucksvoll. Dabei ist es vor allem Eric Roberts, der „The Butcher“ geradezu beherrscht: Während um ihn herum, und wesentlich durch sein Zutun, der Film insbesondere in der zweiten Hälfte der beinahe zweistündigen Laufzeit immer mehr explodiert in einen blutigen Alptraum, scheint sein Merle in jeder Sekunde in sich zu ruhen – wie eine Art Zen-Meister des Tötens. „Vielleicht lebe ich nicht lang, Eddie – aber immerhin länger als du.“ All den großen alten Männern in diesem Film – Roberts, Ironside, Davi –, die sich nach ihren unvergesslichen Kinorollen in den großen Filmen der 1980er und 90er Jahre nun schon dekadenlang durch den Sumpf achtklassiger DTV-Genreproduktionen schlagen, scheint bewusst zu sein, dass es hier um so viel mehr geht als nur einen weiteren hyperblutigen Gangsterfilm. Es ist eine vielleicht letzte Chance, in einem großen Film zu spielen (und wenn das auch niemand merken wird; diese Rollen scheinen viel zu intim, um sie mit allzu vielen Menschen zu teilen); es ist ein Geschenk, eine Wiederaneignung der zwischen Trashfilm und Massenmanufaktur abhanden gekommenen Selbstachtung. Gleichzeitig ist es ein Abschied, eine in einen exquisiten Jazzsoundtrack voller letzter Klänge hineingeschmiegte Hinterlassenschaft an die Nachwelt, die fortan bleiben und immer wieder von einem ausgesuchten, sehr glücklichen Publikum entdeckt werden wird.
 „Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?
„Ich habe nie einen Mann um etwas gebeten. Jetzt wird einfach gestorben.“ Weltabgewandter, jenseitiger als „The Butcher“ kann ein Film kaum sein, und das unaufgeregte, aber niemals ungerührte Spiel von Eric Roberts, für den dies hier ein Alterswerk in der Dimension von Tarantinos „Jackie Brown“ darstellt, behält Johnsons gewagtes Konzept in jedem Moment vor dem Umkippen in Kitsch oder schlichten Gewaltfetisch. Tatsächlich ist „The Butcher“ das erste Meisterwerk eines hochtalentierten, kühnen DTV-Filmemachers und einer der schönsten, sentimentalsten Filme des Kino(video)jahres. „Gefühle sind ein verdammter Luxus“, so heißt es einmal darin, und Merle Hench lächelt nur wissend und ein bisschen traurig. Die getragene Erzählweise, die sanfte Elegik. die hyperbetonten Gewalteruptionen, die erlesene Besetzung noch der kleinsten Nebenrollen – das alles macht „The Butcher“, dem kaum nennenswerten Budget zum Trotz und Widerspruch, zu einem wahrhaft luxuriösen Film. Und warum eigentlich sollte man sich mit weniger zufrieden geben?
The Butcher – The New Scarface
(The Butcher, USA 2007)
Regie & Drehbuch: Jesse V. Johnson; Musik: Marcello Di Francisci; Kamera: Robert Hayes; Schnitt: Ken Blackwell
Darsteller: Eric Roberts, Robert Davi, Irina Björklund, Michael Ironside, Keith David, Bokeem Woodbine, Geoffrey Lewis
Länge: ca. 109 Minuten
Verleih: Mr. Banker/Sunfilm
Zur DVD von Mr. Banker
Hier ist Vorsicht geboten, da neben der ungekürzten Fassung mit JK-Freigabe auch eine um knapp 9 Minuten gekürzte Fassung mit FSK-Siegel KJ existiert. Die ungekürzte DVD des Labels Mr. Banker ist aber tadellos und bietet den Film in guter Bild- und Tonqualität im englischen Originalton mit optionalen deutschen Untertiteln sowie in einer (gerade noch) akzeptablen deutschen Synchronfassung. Ein wenig Bonusmaterial gibt es auch noch.
Bild: 1,85:1 (anamorph)
Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Stereo 2.0), Englisch (Dolby Stereo 2.0)
Untertitel: Deutsch
Extras: Trailer, Teaser, Behind the Scenes, Bildergalerie
FSK: JK
Die Wiedererkämpfung der Heterosexualität
In den 1980er Jahren war Patrick Swayze für einen kurzen Moment ein Kinostar. Nach seinem Debüt auf der großen Leinwand im Kreise des durch Francis Ford Coppolas „The Outsiders“ formierten Brat Pack und dem legendären Desaster als faschistoider Pfadfinder in John Milius’ spektakulär gescheiterter Kalter-Krieg-Satire „Red Dawn“ war Swayze im Jahr 1987 plötzlich der Posterboy No. 1 des Weltkinos. „Dirty Dancing“ war einer der unglaublichsten Kassenhits der Dekade, und sein Hauptdarsteller plötzlich Schwarm aller Backfische zwischen 12 und 52 und Mittelpunkt einer der irritierendsten Camp-Phantasmagorien der Kinogeschichte. Gleichwohl schien Swayze selbst ein wenig erschrocken über den Erfolg des trashig-nostalgischen Musicals und setzte in den folgenden Jahren in seiner Rollenauswahl (recht erfolglos) alles daran, eine überbetonte Maskulinität ins Zentrum des Gezeigten zu rücken.
Ein analoger Superheld für eine digitale Welt
„Isaac“ – Intuitives synthetisches autonomes Angriffs-Commando. Und, wie uns der deutsche Untertitel glauben machen möchte: „Die finale Waffe“. Tatsächlich ist Isaac (Rich Franklin) das Ergebnis eines streng geheimen Rüstungsprogramms der Regierung, das zum Tode verurteilte Mörder zu perfekten Kampfmaschinen für den militärischen Einsatz umbauen will. John Steads Film „Cyborg Soldier“ setzt ein mit der Flucht Isaacs aus jenem Labor, in dem er zur Menschmaschine aufgerüstet und zum Töten umprogrammiert wurde, und folgt ihm auf seiner Flucht vor dem Killerkommando des skrupellosen Dr. Hart (Bruce Greenwood). Der Zufall führt ihn dabei mit der Polizistin Lindsey Reardon (Tiffani Thiessen) zusammen, die eher unbedarft zwischen die Fronten dieses Konfliktes gerät. Im Verlauf der Flucht kehrt die Erinnerung Isaacs an sein früheres Leben langsam zurück, und die finsteren Machenschaften Harts decken sich allmählich auf bis hin zur abschließenden Konfrontation, die sich persönlicher als erwartet gestaltet…
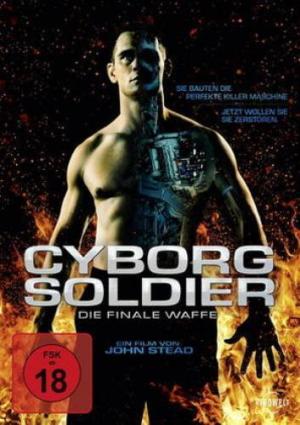 In der Gestalt des Maschinenmenschen manifestierten sich von jeher Sehnsüchte und Problematiken des Aktionskinos. Einerseits galt sie der Science Fiction in schöner Regelmäßigkeit als Spiegel, in dem die verlorenen Menschen ihrer dystopischen Welten ihre längst abhandene Menschlichkeit wiederfanden. Andererseits wird sie zur strukturellen Metapher, die den grundlegenden Zwiespalt des Actionfilms beschreibt, der stets aufs Neue zwischen technokratischer Maschinisierung und dem nachgerade neurotischen Zwang zum Herunterbrechen des überlebensgroßen Geschehens auf menschliches Maß zerrissen zu werden droht. Im Gegensatz zum offenkundig Maschinellen des Roboters und dem antropomorphen Androiden jedoch ist der Cyborg stets beides: gewesener Mensch, an den Spuren des Humanismus sich wider die eigene Programmierung und die Außenwahrnehmung festklammernd, und Maschine, posthumane, mit übermenschlichen Begabungen ausgestattete Existenzform. Hybridwesen, in keiner Welt wirklich zuhause, ewigem Zweifel um die eigene Ontologie ausgeliefert – vom melancholischen „Blade Runner“ Rick Deckard, der seine eigene Menschlichkeit als artifiziell akzeptieren muss, über Paul Verhoevens „RoboCop“ bis hin zu Marcus Wright in McGs fabelhaftem „Terminator Salvation“ oder zur verwirrt-traurigen Young-Goon in Park Chan-Wooks „I’m a Cyborg But That’s OK“, die ihre Menschlichkeit abzuwerfen sucht und sich folgerichtig in einen grellen Science-Fiction-Traum hineinphantasiert.
In der Gestalt des Maschinenmenschen manifestierten sich von jeher Sehnsüchte und Problematiken des Aktionskinos. Einerseits galt sie der Science Fiction in schöner Regelmäßigkeit als Spiegel, in dem die verlorenen Menschen ihrer dystopischen Welten ihre längst abhandene Menschlichkeit wiederfanden. Andererseits wird sie zur strukturellen Metapher, die den grundlegenden Zwiespalt des Actionfilms beschreibt, der stets aufs Neue zwischen technokratischer Maschinisierung und dem nachgerade neurotischen Zwang zum Herunterbrechen des überlebensgroßen Geschehens auf menschliches Maß zerrissen zu werden droht. Im Gegensatz zum offenkundig Maschinellen des Roboters und dem antropomorphen Androiden jedoch ist der Cyborg stets beides: gewesener Mensch, an den Spuren des Humanismus sich wider die eigene Programmierung und die Außenwahrnehmung festklammernd, und Maschine, posthumane, mit übermenschlichen Begabungen ausgestattete Existenzform. Hybridwesen, in keiner Welt wirklich zuhause, ewigem Zweifel um die eigene Ontologie ausgeliefert – vom melancholischen „Blade Runner“ Rick Deckard, der seine eigene Menschlichkeit als artifiziell akzeptieren muss, über Paul Verhoevens „RoboCop“ bis hin zu Marcus Wright in McGs fabelhaftem „Terminator Salvation“ oder zur verwirrt-traurigen Young-Goon in Park Chan-Wooks „I’m a Cyborg But That’s OK“, die ihre Menschlichkeit abzuwerfen sucht und sich folgerichtig in einen grellen Science-Fiction-Traum hineinphantasiert.
Als perfekte Waffensysteme werden die Cyborgs des Science-Fiction-Kinos fürgewöhnlich konzipiert – und vielleicht ist Isaac aus „Cyborg Soldier“ im Grunde wirklich die perfekte Waffe. Das hieße hier: die menschlichste Waffe, insofern er sich in Testreihen als des Tötens unfähig erweist, sofern er keiner Attacke ausgesetzt ist. Eine Waffe für ein Zeitalter strikter Verteidigungskriege also, eine pazifistische Waffe. Würde ein Waffensystem nach dem Modell von Isaac folglich zum Einsatz kommen, so würde dies nicht nur den Schutz gegen potentielle Angreifer bedeuten, sondern auch eine Absicherung gegen kriegerische Übergriffe aus den eigenen Reihen bedeuten. Eine kontextabhängige Waffe, die nur noch auf die eigene Bedrohung reagieren könnte und der grenzen- und übergesetzlichen Machtausübung des Stärkeren einen Riegel vorschieben würde, somit die eigene Militärpolitik nachhaltig prägen würde. Schlussendlich ist es auch in „Cyborg Soldier“ der Befehl, Unschuldige zu töten, der Isaac dazu bringt, aus seinem Gefängnis und seiner vorgesehenen Rolle als Killermaschine auszubrechen und sich auf die Suche nach seiner gelöschten Erinnerung und vergessenen Menschlichkeit zu machen. Und einmal mehr ist es am Ende der Maschinenmensch, der im Selbstopfer ein korruptes System zerstört und sich spätestens im eigenen Vergehen als letzter wahrer Kämpfer für das Menschliche in einer von instrumenteller Vernunft geprägten Welt erweist.
John Steads Film überrascht vielleicht vor allem durch seine Seriosität: Mit einfachsten Mitteln und kleinem Budget inszeniert, hält er sich doch über weite Strecken in weiter Distanz vom Trashterrain des Gros der Cyborg-Actioner der 1980er und 1990er Jahre, mit denen das B-Kino auf den großen Erfolg von James Camerons zwei „Terminator“-Filmen reagierte. Stattdessen gibt sich „Cyborg Soldier“ als geradezu klassisch entwickeltes Science-Fiction-Kino, irgendwo zwischen „RoboCop“ und John Carpenters „Starman“. Angenehm ernsthaft und meisterhaft verdichtet, findet er eine ganze Reihe großartiger Bilder einerseits in den verschneiten Wäldern Kanadas, andererseits in den klaustrophobischen Fluren des geheimen Laborsystems. Großes Kino im kleinen Format.
Cyborg Soldier
(USA 2008)
Regie: John Stead; Buch: John Stead, John Flock, Christopher Warre Smets; Musik: Ryan Latham; Kamera: David Mitchell; Schnitt: Mark Sanders
Darsteller: Rich Franklin, Bruce Greenwood, Tiffani Thiessen, Aaron Abrams, Wendy Anderson, Steve Lucescu, Simon Northwood, Kevin Rushton, Brian Frank u.a.
Länge: 85 Min.
Verleih: Kinowelt
Zur DVD von Kinowelt
Die Bild- und Tonqualität der Kinowelt-DVD sind hervorragend. Als Bonusmaterial ist immerhin ein 15-minütiges Making-of enthalten sowie 2 Trailer und eine Fotogalerie.
Bild: 1,78:1
Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Stereo), Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Making-of, Trailer, Fotogalerie
FSK: Keine Jugendfreigabe
The Making and Unmaking of Jean-Claude Van Damme
JCVD – ein Filmtitel, wie er luzider kaum sein könnte. JCVD, das ist Jean-Claude Van Damme, und im Grunde ist das bereits das Wesentliche, was man über einen Film mit Jean-Claude Van Damme wissen muss. „JCVD“ ist nicht einfach nur ein Film mit Jean-Claude Van Damme, aber dazu später mehr.
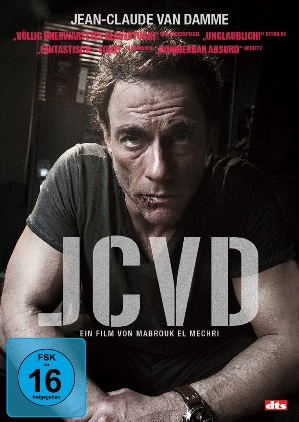 Vor einer Annäherung an Mabrouk El Mechris Film müsste ein Nachdenken über die Karriere und den Rollentypus des Jean-Claude Van Damme stehen, denn letztlich entschlüsselt sich wesentlich vor dessen Hintergrund das Oeuvre des Belgiers, und dann vor allem auch „JCVD“. Van Damme, das war im Grunde immer einer der Guten, auch wenn das meist keiner so richtig gemerkt hat. Vielleicht war es vor allem der Zeitgeist, der an ihm vorüber gezogen war – auch, wenn er ihn zunächst in den Himmel zu tragen schien. Der Durchbruch gelang dem belgischen Karatemeister 1986 mit einer Schurkenrolle in der US-asiatischen Coproduktion „No Retreat, No Surrender“, die hierzulande unter dem Titel „Karate Tiger“ eine schier endlose Filmreihe begründete, deren einzelne Beiträge meist rein gar nichts miteinander zu tun hatten. 1986, das war das Jahr, in dem die Überikonen des Actionkinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität befanden und sich mit „Cobra“ einerseits, und „Raw Deal“ andererseits, ein Duell um Publikumsgunst und Box Office lieferten. Das Actionkino war eine Wachstumsbranche, und folgerichtig zog es Kampfsportmeister aus aller Welt vor die Kamera, um in die überlebensgroßen Fußstapfen der Hyperstars zu treten. Eine überaus virile B-Movie-Industrie pumpte einen schnell und günstig produzierten Prügel- & Schießfilm nach dem anderen in einen stets nach mehr verlangenden Markt hinein, und die mal mehr, mal weniger kinematographisch kompatiblen Recken dieser kleinen Filme einte vor allem der Traum, die Nachfolge der allmählich, aber unaufhaltsam alternden Stallone und Schwarzenegger antreten zu können und zum größten Actionhelden des Planeten zu werden. Ihre Stunde schien dann in den späten 80ern und frühen 90ern gekommen: Die Actionikonen sahen sich – vorerst – an den Grenzen ihrer Körperlichkeit angekommen und versuchten sich, mit eher mediokrem Erfolg, an einer zweiten Karriere als Komödiendarsteller. Und im Gegenzug wurden die Produktionen eines Van Damme oder auch Steven Seagal größer, aufwendiger, ambitionierter – der Sprung in die A-Liga schien für einen Moment lang, mit „Universal Soldier“ oder „Timecop“ für Van Damme oder mit „Under Siege“ für Seagal, möglich. Nur dass dann die A-Liga aufhörte zu existieren. Mit der Marginalisierung von Stallone und Schwarzenegger – die dann freilich noch über Jahre verschleppt und erst allmählich sichtbar wurde – starb auch das Kino, für das sie standen, und somit stießen die natürlichen Erben ihrer Rollen an neu gesetzte Grenzen.
Vor einer Annäherung an Mabrouk El Mechris Film müsste ein Nachdenken über die Karriere und den Rollentypus des Jean-Claude Van Damme stehen, denn letztlich entschlüsselt sich wesentlich vor dessen Hintergrund das Oeuvre des Belgiers, und dann vor allem auch „JCVD“. Van Damme, das war im Grunde immer einer der Guten, auch wenn das meist keiner so richtig gemerkt hat. Vielleicht war es vor allem der Zeitgeist, der an ihm vorüber gezogen war – auch, wenn er ihn zunächst in den Himmel zu tragen schien. Der Durchbruch gelang dem belgischen Karatemeister 1986 mit einer Schurkenrolle in der US-asiatischen Coproduktion „No Retreat, No Surrender“, die hierzulande unter dem Titel „Karate Tiger“ eine schier endlose Filmreihe begründete, deren einzelne Beiträge meist rein gar nichts miteinander zu tun hatten. 1986, das war das Jahr, in dem die Überikonen des Actionkinos, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität befanden und sich mit „Cobra“ einerseits, und „Raw Deal“ andererseits, ein Duell um Publikumsgunst und Box Office lieferten. Das Actionkino war eine Wachstumsbranche, und folgerichtig zog es Kampfsportmeister aus aller Welt vor die Kamera, um in die überlebensgroßen Fußstapfen der Hyperstars zu treten. Eine überaus virile B-Movie-Industrie pumpte einen schnell und günstig produzierten Prügel- & Schießfilm nach dem anderen in einen stets nach mehr verlangenden Markt hinein, und die mal mehr, mal weniger kinematographisch kompatiblen Recken dieser kleinen Filme einte vor allem der Traum, die Nachfolge der allmählich, aber unaufhaltsam alternden Stallone und Schwarzenegger antreten zu können und zum größten Actionhelden des Planeten zu werden. Ihre Stunde schien dann in den späten 80ern und frühen 90ern gekommen: Die Actionikonen sahen sich – vorerst – an den Grenzen ihrer Körperlichkeit angekommen und versuchten sich, mit eher mediokrem Erfolg, an einer zweiten Karriere als Komödiendarsteller. Und im Gegenzug wurden die Produktionen eines Van Damme oder auch Steven Seagal größer, aufwendiger, ambitionierter – der Sprung in die A-Liga schien für einen Moment lang, mit „Universal Soldier“ oder „Timecop“ für Van Damme oder mit „Under Siege“ für Seagal, möglich. Nur dass dann die A-Liga aufhörte zu existieren. Mit der Marginalisierung von Stallone und Schwarzenegger – die dann freilich noch über Jahre verschleppt und erst allmählich sichtbar wurde – starb auch das Kino, für das sie standen, und somit stießen die natürlichen Erben ihrer Rollen an neu gesetzte Grenzen.
 Anders freilich als Steven Seagal, der sich recht bald in sein Schicksal zu ergeben schien und lustlos, resigniert und körperlich verfallend einen unambitionierten Streifen nach dem anderen herunterzukurbeln begann, schien Van Damme eher als tragische Figur greifbar zu werden. In seinem Regiedebüt „The Quest“ oder in Peter MacDonalds „Legionnaire“ versuchte er, im kleinen Maßstab an Hollywoods Tradition des großen, romantischen Abenteuerkinos anzuknüpfen – und lief stets aufs Neue mit dem Kopf gegen die Wand. Mit „Sudden Death“ legte er eine grundsolide Miniatur nach dem klassischen „Die Hard“-Modell vor, mit „Nowhere to Run“ oder „Lionheart“ Versuche eines eher dramatisch begriffenen Aktionskinos. Und dann sind da noch die Arbeiten mit den großen Regisseuren der Hongkonger New Wave, Ringo Lam, Tsui Hark und natürlich John Woo, mit denen er an den seinerzeitigen state of the art des internationalen Bewegungskinos anzudocken suchte. Vielleicht war er hier, im gloriosen und bis heute missverstandenen „Knock Off“ vor allem, für ein paar wenige Filme gar seiner Zeit voraus. Der Zeitgeist freilich war seinerzeit woanders: Die Bruckheimer-Schule kam auf die lukrative Idee, vornehmlich Charakterdarsteller in teuren, polierten Blockbusterkonstrukten zu besetzen und so sehr erfolgreich neue Publikumsschichten zu erschließen. Ein intellektuell sicher nicht avancierterer High-Concept-Actioner wie „The Rock“ oder „Con Air“ wurde so plötzlich interessant für ein Publikum, das sich einen Film mit Van Damme niemals ansehen würde. Um die Jahrtausendwende herum, nach einer Reihe von Flops mit ambitionierten Projekten, schien es dann für eine Weile so, als würde die Luft für Van Damme endgültig dünn. Immer tiefer in den Videothekenregalen verschwanden seine Filme, immer niedriger wurden offenkundig die Budgets und der kreative Aufwand, der für ihre Entstehung betrieben wurde. Als eine Brücke freilich durch dieses Tal der Tränen hin zu einem durch Philippe Martinez’ famosen „Wake of Death“ eingeleiteten Spätwerk, das clever bis melancholisch mit dem eigenen Alterungsprozess umgeht, sind aus heutiger Perspektive die betont finsteren Ringo-Lam-Filme „Replicant“ und „In Hell“ zu lesen, in denen sich jene Dekonstruktion der eigenen Rollenpersona, die nun in „JCVD“ ihren Höhepunkt erreicht, bereits ankündigt. Denn Van Damme, das war bis dahin vor allem: Der Aufrechte. Der Sympathieträger. Auch: der Jungenhafte. Und doch oft, nicht zuletzt: der Melancholiker. Ein Actionheld wider Willen, im Grunde nur zur falschen Zeit am falschen Ort, und ein Stück weit von der Gewalt mitgerissen. In den gemeinsamen Filmen mit Ringo Lam spätestens trat dieses Getriebensein deutlich hervor, und somit entstand eine Abgründigkeit, die erst den Nährboden für das Alterswerk des Jean-Claude Van Damme bilden konnte.
Anders freilich als Steven Seagal, der sich recht bald in sein Schicksal zu ergeben schien und lustlos, resigniert und körperlich verfallend einen unambitionierten Streifen nach dem anderen herunterzukurbeln begann, schien Van Damme eher als tragische Figur greifbar zu werden. In seinem Regiedebüt „The Quest“ oder in Peter MacDonalds „Legionnaire“ versuchte er, im kleinen Maßstab an Hollywoods Tradition des großen, romantischen Abenteuerkinos anzuknüpfen – und lief stets aufs Neue mit dem Kopf gegen die Wand. Mit „Sudden Death“ legte er eine grundsolide Miniatur nach dem klassischen „Die Hard“-Modell vor, mit „Nowhere to Run“ oder „Lionheart“ Versuche eines eher dramatisch begriffenen Aktionskinos. Und dann sind da noch die Arbeiten mit den großen Regisseuren der Hongkonger New Wave, Ringo Lam, Tsui Hark und natürlich John Woo, mit denen er an den seinerzeitigen state of the art des internationalen Bewegungskinos anzudocken suchte. Vielleicht war er hier, im gloriosen und bis heute missverstandenen „Knock Off“ vor allem, für ein paar wenige Filme gar seiner Zeit voraus. Der Zeitgeist freilich war seinerzeit woanders: Die Bruckheimer-Schule kam auf die lukrative Idee, vornehmlich Charakterdarsteller in teuren, polierten Blockbusterkonstrukten zu besetzen und so sehr erfolgreich neue Publikumsschichten zu erschließen. Ein intellektuell sicher nicht avancierterer High-Concept-Actioner wie „The Rock“ oder „Con Air“ wurde so plötzlich interessant für ein Publikum, das sich einen Film mit Van Damme niemals ansehen würde. Um die Jahrtausendwende herum, nach einer Reihe von Flops mit ambitionierten Projekten, schien es dann für eine Weile so, als würde die Luft für Van Damme endgültig dünn. Immer tiefer in den Videothekenregalen verschwanden seine Filme, immer niedriger wurden offenkundig die Budgets und der kreative Aufwand, der für ihre Entstehung betrieben wurde. Als eine Brücke freilich durch dieses Tal der Tränen hin zu einem durch Philippe Martinez’ famosen „Wake of Death“ eingeleiteten Spätwerk, das clever bis melancholisch mit dem eigenen Alterungsprozess umgeht, sind aus heutiger Perspektive die betont finsteren Ringo-Lam-Filme „Replicant“ und „In Hell“ zu lesen, in denen sich jene Dekonstruktion der eigenen Rollenpersona, die nun in „JCVD“ ihren Höhepunkt erreicht, bereits ankündigt. Denn Van Damme, das war bis dahin vor allem: Der Aufrechte. Der Sympathieträger. Auch: der Jungenhafte. Und doch oft, nicht zuletzt: der Melancholiker. Ein Actionheld wider Willen, im Grunde nur zur falschen Zeit am falschen Ort, und ein Stück weit von der Gewalt mitgerissen. In den gemeinsamen Filmen mit Ringo Lam spätestens trat dieses Getriebensein deutlich hervor, und somit entstand eine Abgründigkeit, die erst den Nährboden für das Alterswerk des Jean-Claude Van Damme bilden konnte.
Das alles sollte man wissen, wenn man damit beginnt, über „JCVD“ nachzudenken. Und das weiß auch der Film, der schier genialisch beginnt. In einer langen, wuchtigen Plansequenz prügelt sich da Van Damme durch eine schier endlose Kaskade von Angreifern, wie in alten Zeiten und vielleicht noch ein bisschen toller. Dann, nach Minuten reiner Bewegungspoesie, tritt der Held durch eine Tür, die Tür schlägt zu – und die Kulisse fällt um. Nach hinten. Nicht die vierte Wand fällt, sondern zunächst – wenn man so will – die erste. Bevor sich „JCVD“ später nach vorn öffnet, in den Zuschauerraum und die Welt hinein, öffnet er sich in seine eigene Tiefe und die seines Protagonisten, der Kunstfigur Jean-Claude Van Damme. Dessen Rollengeschichte kommt auch dann zum Tragen, wenn sich der Regisseur des Film-im-Film als Karikatur eines asiatischen Jungfilmers entpuppt, der desinteressiert und voller Verachtung seinem Job nachgeht, während der sichtlich außer Atem geratene Van Damme verzweifelt versucht, etwas Herzblut in den Film einfließen zu lassen. Und außerdem klarstellt, dass er solche langen Plansequenzen mit vollem Körpereinsatz zu drehen kaum noch imstande ist. Schließlich ist er bereits 47 Jahre alt. Die Sequenz, und damit der Titelvorspann, endet mit einem verbrauchten, müden Actionhelden, der seinen Blick direkt in die Kamera und somit auf uns richtet. El Mechri bringt die Bewegungspoesie von Jean-Claude Van Dammes Kino für diesen Moment zum Stillstand, ganz buchstäblich zur Kunstpause. Denn mehr Bewegung ist eben nicht automatisch mehr Poesie. Dies ist kein normaler Jean-Claude-Van-Damme-Film.
 In der Folge sehen wir einem Titelhelden beim verzweifelten Manövrieren in einer Sackgasse seiner Karriere wie seines Privatlebens zu. Von (authentischen) Drogenproblemen geplagt und in einem (ebenso authentischen) Sorgerechtsprozess um Sohn Nicholas aufgerieben, nimmt der Schauspieler eine würdelose C-Picture-Rolle nach der anderen an – und kommt allmählich an dem Punkt an, an dem ihm bereits der noch tiefer gesunkene Kollege Seagal die Rollen wegschnappt. Weil er verspricht, sich sein Zöpfchen abzuschneiden. Kurz vor dem endgültigen Verzweifeln stolpert dieser Actionstar und Antiheld nun in eine Geiselnahme in einem belgischen Postamt hinein – und löst somit eine Kettenreaktion im Innen und Außen des besetzten Raumes aus. Im Inneren insofern, als sich an der Konfrontation mit dem als Kinostar erkannten Van Damme die Konflikte in der Gruppe der Kidnapper verschärfen bis hin zur finalen Eskalation, und im Außen, wo sich alsbald ein gigantischer Medienrummel um den fälschlicherweise für den Verbrecher gehaltenen Van Damme bildet. Der Plot wogt nun ein wenig hin und her – und streift dabei auch durchaus gelegentlich ein wenig ausgetreten wirkendes Tarantino-Territorium –, und löst sich schließlich in einem bittersüßen Ende in Wohlgefallen auf. Die zentrale Sequenz von „JCVD“ findet sich jedoch eher im Zentrum des Films. Da nämlich trägt es den Hauptdarsteller und Helden für mehrere Minuten aus der fiktiven Welt hinaus – beziehungsweise: über diese hinaus. Nicht behind, sondern eher above the scenes spricht Van Damme einen mehrminütigen Monolog direkt in die Kamera, über sein Leben, seine Karriere, sein Scheitern. Über das Versprechen, das er einst dem Publikum gemacht hat und das er bis heute nicht eingelöst sieht. Über seine Sehnsucht, endlich bessere Filme zu machen. Spätestens in dieser Sequenz finden sich endgültig alle Begrenzungen von „JCVD“ niedergerissen, verschwimmen Rollenpersona und Privatperson, Film und Film-im-Film und die Realität zumindest der Klatschspaltenwelt ineinander, gehen Kunstfilm und Genrekino ineinander auf. Hier zeigt sich auch exemplarisch, was „JCVD“ nicht ist. Weder als Pop Art noch als reines Meta-Kino im Geiste Charlie Kaufmans lässt sich Mabrouk El Mechris Film wirklich fassen, und schon gar nicht als schnöde Persiflage. Tatsächlich ist „JCVD“ ein Genrefilm, der das Genre erweitert, statt es hinter sich zu lassen. Der sich elegant darüber erhebt wie sein Held über die Kulissen und zwischen Kameras und Scheinwerfern weiter davon spricht. Keine nachhaltige Dekonstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion, im Geiste jenes Versprechens, das seinen Protagonisten mit uns, seinen Zuschauern, verbindet.
In der Folge sehen wir einem Titelhelden beim verzweifelten Manövrieren in einer Sackgasse seiner Karriere wie seines Privatlebens zu. Von (authentischen) Drogenproblemen geplagt und in einem (ebenso authentischen) Sorgerechtsprozess um Sohn Nicholas aufgerieben, nimmt der Schauspieler eine würdelose C-Picture-Rolle nach der anderen an – und kommt allmählich an dem Punkt an, an dem ihm bereits der noch tiefer gesunkene Kollege Seagal die Rollen wegschnappt. Weil er verspricht, sich sein Zöpfchen abzuschneiden. Kurz vor dem endgültigen Verzweifeln stolpert dieser Actionstar und Antiheld nun in eine Geiselnahme in einem belgischen Postamt hinein – und löst somit eine Kettenreaktion im Innen und Außen des besetzten Raumes aus. Im Inneren insofern, als sich an der Konfrontation mit dem als Kinostar erkannten Van Damme die Konflikte in der Gruppe der Kidnapper verschärfen bis hin zur finalen Eskalation, und im Außen, wo sich alsbald ein gigantischer Medienrummel um den fälschlicherweise für den Verbrecher gehaltenen Van Damme bildet. Der Plot wogt nun ein wenig hin und her – und streift dabei auch durchaus gelegentlich ein wenig ausgetreten wirkendes Tarantino-Territorium –, und löst sich schließlich in einem bittersüßen Ende in Wohlgefallen auf. Die zentrale Sequenz von „JCVD“ findet sich jedoch eher im Zentrum des Films. Da nämlich trägt es den Hauptdarsteller und Helden für mehrere Minuten aus der fiktiven Welt hinaus – beziehungsweise: über diese hinaus. Nicht behind, sondern eher above the scenes spricht Van Damme einen mehrminütigen Monolog direkt in die Kamera, über sein Leben, seine Karriere, sein Scheitern. Über das Versprechen, das er einst dem Publikum gemacht hat und das er bis heute nicht eingelöst sieht. Über seine Sehnsucht, endlich bessere Filme zu machen. Spätestens in dieser Sequenz finden sich endgültig alle Begrenzungen von „JCVD“ niedergerissen, verschwimmen Rollenpersona und Privatperson, Film und Film-im-Film und die Realität zumindest der Klatschspaltenwelt ineinander, gehen Kunstfilm und Genrekino ineinander auf. Hier zeigt sich auch exemplarisch, was „JCVD“ nicht ist. Weder als Pop Art noch als reines Meta-Kino im Geiste Charlie Kaufmans lässt sich Mabrouk El Mechris Film wirklich fassen, und schon gar nicht als schnöde Persiflage. Tatsächlich ist „JCVD“ ein Genrefilm, der das Genre erweitert, statt es hinter sich zu lassen. Der sich elegant darüber erhebt wie sein Held über die Kulissen und zwischen Kameras und Scheinwerfern weiter davon spricht. Keine nachhaltige Dekonstruktion, sondern eher eine Rekonstruktion, im Geiste jenes Versprechens, das seinen Protagonisten mit uns, seinen Zuschauern, verbindet.
JCVD
(Belgien / Luxemburg / Frankreich 2008)
Regie: Mabrouk El Mechri; Buch: Mabrouk El Mechri, Frédéric Benudis, Christophe Turpin; Musik: Gast Waltzing; Kamera: Pierre-Yves Bastard; Schnitt: Kako Kelber
Darsteller: Jean-Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem, Karim Belkhadra, Jean-François Wolff, Anne Paulicevich, Liliane Becker u.a.
Länge: 93 Min.
Verleih: Koch Media
Zur DVD von Koch Media
Mit der 2-Disc Edition hat Koch Media einmal mehr eine tadellose DVD-Veröffentlichung vorgelegt. Die Bild- und Tonqualität ist tadellos, und insbesondere mit den zwei langen Dokumentationen auf der Bonus-DVD sowie der Teaser-Kollektion auf der Film-DVD, bei der es sich im Grunde um eine Reihe eigenständiger Kurzfilme handelt, ist einiges höchst interessante Material zur weiteren Kontextualisierung und Vertiefung des Filmes vorhanden.
Bild: 2,35:1
Ton: Deutsch, Französisch/Englisch (DTS, Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Audiokommentar mit Mabrouk El Mechri, 6 Teaser, Geschnittene Szenen mit optionalem Kommentar des Regisseurs, Vent d’Ame (Making of), Ein Tag im Leben von JCVD, Synchro-Outtake mit Charles Rettinghaus
FSK: ab 16 Jahren
Berührung und Differenz
Der zweite (oder, wie mancher wohl behaupten würde, erste) Frühling des Dolph Lundgren ist zweifelsohne zu den überraschendsten Karrieren im noch jungen Kino des 21. Jahrhunderts zu zählen – und, wie passend, wohl hauptsächlich dem Zufall zu verdanken. Das erstaunliche Comeback Lundgrens als Actiondarsteller ist immerhin ganz wesentlich mit dessen neuem Profil als Autorenfilmer verbunden, und diese Rolle ist wohl in erster Linie dem labilen Gesundheitszustand Sidney J. Furies zu verdanken. Erst als dieser kurz vor Drehbeginn von „The Defender“ passen musste, übernahm nämlich Lundgren die Regie des schon detailliert geplanten Projektes – und verlieh dem Film doch einen individuellen, frischen Touch, der unter Furies Regie so kaum vorstellbar wäre. In der Folge bestätigte Lundgren sein Talent mit den weiteren Regiearbeiten „The Mechanik“ und „Missionary Man“ (sowie dem offiziell von Shimon Dotan inszenierten, Gerüchten zufolge aber während der Dreharbeiten von Lundgren übernommenen, in impressionistischen Stimmungsbildern schwelgenden „Diamond Dogs“) nicht nur, sondern schien gar von Film zu Film souveräner und ambitionierter zu werden. Mit „Direct Contact“ begab er sich nun zum ersten Mal seit 2004 – den obskuren Bibelfilm „L’Inchiesta“, in dem Lundgren in einer Nebenrolle auftaucht, mal außer Acht gelassen – in die Hände eines anderen Regisseurs, und prompt hält auch durchaus eine gewisse stilistische Wankelmütigkeit Einzug. So ungebrochen stilisiert wie Lundgren in seinen Postwestern geht Danny Lerner kaum ans Werk, und tatsächlich verfügt „Direct Contact“ über eine ganze Reihe von Charakteristika, die ihn nach klassisch filmkritischem Verständnis wohl als „misslungen“ markieren würden.
 So ist etwa zu den auffälligeren Merkmalen von Lerners Film der extensive Einsatz von stock footage zu zählen – eine klassische Verfahrensweise des B-Movies, einem Werk mehr Schauwert zu verleihen, als das schmale Budget hergibt. Statt aufwendige Aktionssequenzen zu inszenieren (oder Naturaufnahmen an exotischen Schauplätzen, oder eben alles, was sich als Erscheinungsform „reinen Spektakels“ in den Film integrieren lässt), greift der Filmemacher hier auf bereits vorhandenes, in früheren Filmproduktionen verwendetes oder im Archiv gelagertes Material zurück und verfügt nun bereits über eine Reihe von Eckpunkten, um die herum er nun das neu inszenierte Material zu arrangieren hat. Dies stellt nun natürlich vor die Herausforderung, aus diesen unter Umständen vollkommen disparaten Versatzstücken heraus eine Art Geschlossenheit herzustellen, die die unterschiedlichen Genealogien des verwendeten Materials möglichst perfekt verschleiert. Zumindest wäre dies die Anforderung, die zur klassischen Vorstellung eines „gut gemachten“ Films im Sinne des amerikanischen Modells führen würde: eine unsichtbare Montage mit dem Ziel der Kreation einer möglichst ungebrochenen filmischen Ganzheit, hier eben nur vor eine zusätzliche Hürde gestellt. Der grundsätzlich illusionistische Charakter des Kinos wäre im Rahmen einer solchen Perspektive absolut und nicht in Frage zu stellen, und einen Film zu machen, das wäre diesem Modell zufolge ein bisschen so, wie einen Pullover zu stricken. Ein Handwerk, das grundsätzlich ähnliche Vorgehensweisen seitens des Ausführenden, der demzufolge kaum Künstler, höchstens Kunsthandwerker wäre, erfordert, und das sich verkompliziert mit der Anzahl der Fäden, die hier zu verschlingen und im Überblick (produzenten- wie rezipientenseitig) zu behalten sind. Das mag zwar im Falle gewisser Ansprüche an das Kino eine legitime Sichtweise sein, es ist gleichwohl natürlich auch eine äußerst langweilige, schon deswegen, weil sie in letzter Konsequenz auf ein bloßes Abfragen eines Filmes nach einem immer gleichen Kriterienkatalog hinausläuft und somit auf eine ewig redundante Bestätigung und Reproduktion eines Wissens vom Kino, das man immer und immer wieder auch schon vorher hatte.
So ist etwa zu den auffälligeren Merkmalen von Lerners Film der extensive Einsatz von stock footage zu zählen – eine klassische Verfahrensweise des B-Movies, einem Werk mehr Schauwert zu verleihen, als das schmale Budget hergibt. Statt aufwendige Aktionssequenzen zu inszenieren (oder Naturaufnahmen an exotischen Schauplätzen, oder eben alles, was sich als Erscheinungsform „reinen Spektakels“ in den Film integrieren lässt), greift der Filmemacher hier auf bereits vorhandenes, in früheren Filmproduktionen verwendetes oder im Archiv gelagertes Material zurück und verfügt nun bereits über eine Reihe von Eckpunkten, um die herum er nun das neu inszenierte Material zu arrangieren hat. Dies stellt nun natürlich vor die Herausforderung, aus diesen unter Umständen vollkommen disparaten Versatzstücken heraus eine Art Geschlossenheit herzustellen, die die unterschiedlichen Genealogien des verwendeten Materials möglichst perfekt verschleiert. Zumindest wäre dies die Anforderung, die zur klassischen Vorstellung eines „gut gemachten“ Films im Sinne des amerikanischen Modells führen würde: eine unsichtbare Montage mit dem Ziel der Kreation einer möglichst ungebrochenen filmischen Ganzheit, hier eben nur vor eine zusätzliche Hürde gestellt. Der grundsätzlich illusionistische Charakter des Kinos wäre im Rahmen einer solchen Perspektive absolut und nicht in Frage zu stellen, und einen Film zu machen, das wäre diesem Modell zufolge ein bisschen so, wie einen Pullover zu stricken. Ein Handwerk, das grundsätzlich ähnliche Vorgehensweisen seitens des Ausführenden, der demzufolge kaum Künstler, höchstens Kunsthandwerker wäre, erfordert, und das sich verkompliziert mit der Anzahl der Fäden, die hier zu verschlingen und im Überblick (produzenten- wie rezipientenseitig) zu behalten sind. Das mag zwar im Falle gewisser Ansprüche an das Kino eine legitime Sichtweise sein, es ist gleichwohl natürlich auch eine äußerst langweilige, schon deswegen, weil sie in letzter Konsequenz auf ein bloßes Abfragen eines Filmes nach einem immer gleichen Kriterienkatalog hinausläuft und somit auf eine ewig redundante Bestätigung und Reproduktion eines Wissens vom Kino, das man immer und immer wieder auch schon vorher hatte.
 Tritt man nun aber, jenseits des „gut“ oder „schlecht Gemachten“ in ein Kommunikationsverhältnis zu dem Film „Direct Contact“, so tun sich mit einem Mal Sinnebenen auf, welche die Beschäftigung mit diesem Artefakt sehr gewinnbringend erscheinen lassen können. Schon der Titel „Direct Contact“ wird nun als Kommentar auf die Struktur des Filmes lesbar, indem er seine inhärente Doppeldeutigkeit entfaltet. Der Kontakt, das meint schließlich nicht nur die Nähe, sondern immer gleichzeitig auch die Distanz; die Berührung betont stets auch die grundlegende Alterität. Und Danny Lerners Film oszilliert zwischen diesen beiden Polen: Die mangelnde Perfektion in seiner Bemühung, eine durchgehende kinematographische Bewegung im Collagieren von disparatem Material auszuformen, reißt Lücken zwischen den Bildern auf, durch die der filmische Produktionsprozess durchscheint. Somit lässt sich „Direct Contact“ etwa ebenso mühelos als Allegorie auf den arbeitsteiligen Prozess des Filmemachens selbst wie als konsequente Offenlegung des illusionistischen Charakters der Montage lesen. Im Auseinanderklaffen zwischen zwei Sequenzen – mehr noch: zwischen Ursache und Wirkung – kommt das grundsätzlich Achronologische des Kinos ins Spiel, das durch avanciertere Montagetechniken fürgewöhnlich aus dem Blickfeld gerät, und zersetzt die nicht mehr als geschlossen wahrnehmbare Welt der filmischen Narration. Der Stellenwert der Aktionssequenz selbst verschiebt sich also vor der Erzählweise von „Direct Contact“, der dies auch in seinen schönsten Momenten buchstäblich zelebriert. So in einer der zahlreichen Autoverfolgungsjagden, die den Helden Mike Riggins durch den sich immer wieder umschichtenden Plot um ein Kidnapping, das sich in der Flexibilisierung der Frontlinien durch die diversen Demaskierungen des Verschwörungsplots gewissermaßen verdoppelt, tragen: Funken sprühen, Glas splittert, farbiges Licht und Explosionen gemahnen hier vor allem an ein Feuerwerk. Die Herauslösung des Spektakels aus dem Filmganzen und die Überführung in für sich selbst stehende, isolierte Bilder, von jenen den Plot transportierenden Sequenzen geradezu umflossen, lassen diese Momente von einem Hauch des Erhabenen umwehen. Die Explosion, die Destruktion, das Spektakel, der Schauwert – das alles ist hier nicht mehr als ein Bestandteil (unter verschiedenen, gleichwertigen) des Filmbildes zu klassifizieren. Stattdessen wird es zu seinem Fluchtpunkt.
Tritt man nun aber, jenseits des „gut“ oder „schlecht Gemachten“ in ein Kommunikationsverhältnis zu dem Film „Direct Contact“, so tun sich mit einem Mal Sinnebenen auf, welche die Beschäftigung mit diesem Artefakt sehr gewinnbringend erscheinen lassen können. Schon der Titel „Direct Contact“ wird nun als Kommentar auf die Struktur des Filmes lesbar, indem er seine inhärente Doppeldeutigkeit entfaltet. Der Kontakt, das meint schließlich nicht nur die Nähe, sondern immer gleichzeitig auch die Distanz; die Berührung betont stets auch die grundlegende Alterität. Und Danny Lerners Film oszilliert zwischen diesen beiden Polen: Die mangelnde Perfektion in seiner Bemühung, eine durchgehende kinematographische Bewegung im Collagieren von disparatem Material auszuformen, reißt Lücken zwischen den Bildern auf, durch die der filmische Produktionsprozess durchscheint. Somit lässt sich „Direct Contact“ etwa ebenso mühelos als Allegorie auf den arbeitsteiligen Prozess des Filmemachens selbst wie als konsequente Offenlegung des illusionistischen Charakters der Montage lesen. Im Auseinanderklaffen zwischen zwei Sequenzen – mehr noch: zwischen Ursache und Wirkung – kommt das grundsätzlich Achronologische des Kinos ins Spiel, das durch avanciertere Montagetechniken fürgewöhnlich aus dem Blickfeld gerät, und zersetzt die nicht mehr als geschlossen wahrnehmbare Welt der filmischen Narration. Der Stellenwert der Aktionssequenz selbst verschiebt sich also vor der Erzählweise von „Direct Contact“, der dies auch in seinen schönsten Momenten buchstäblich zelebriert. So in einer der zahlreichen Autoverfolgungsjagden, die den Helden Mike Riggins durch den sich immer wieder umschichtenden Plot um ein Kidnapping, das sich in der Flexibilisierung der Frontlinien durch die diversen Demaskierungen des Verschwörungsplots gewissermaßen verdoppelt, tragen: Funken sprühen, Glas splittert, farbiges Licht und Explosionen gemahnen hier vor allem an ein Feuerwerk. Die Herauslösung des Spektakels aus dem Filmganzen und die Überführung in für sich selbst stehende, isolierte Bilder, von jenen den Plot transportierenden Sequenzen geradezu umflossen, lassen diese Momente von einem Hauch des Erhabenen umwehen. Die Explosion, die Destruktion, das Spektakel, der Schauwert – das alles ist hier nicht mehr als ein Bestandteil (unter verschiedenen, gleichwertigen) des Filmbildes zu klassifizieren. Stattdessen wird es zu seinem Fluchtpunkt.
Direct Contact
(USA/Deutschland 2009)
Regie: Danny Lerner; Buch: Danny Lerner, Les Welden; Musik: Stephen Edwards; Kamera: Ross W. Clarkson; Schnitt: Michele Gisser
Darsteller: Dolph Lundgren, Michael Paré, Gina May, James Chalke, Bashar Rahal, Vladimir Vladimirov, Raicho Vasilev, Nikolay Stanoev u.a.
Länge: 87 Min.
Verleih: Kinowelt
Zur DVD von Kinowelt
Qualitativ ist die DVD von Kinowelt tadellos ausgefallen. Die Bild- und Tonqualität sind hervorragend, die deutsche Synchronfassung ist durchaus akzeptabel ausgefallen. Bonusmaterial ist hingegen so gut wie keines vorhanden, jedenfalls nichts von Interesse.
Bild: 1,78:1
Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1, Dolby Surround), Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Trailer, Fotogalerie
FSK: JK – Keine schwere Jugendgefährdung
Geretteter Lebensretter aus Todessehnsucht
Zuerst nur ein dumpfer Herzschlag, millisekundenkurze Bilder, viel Schwarz. Ein Autounfall, eine schöne und vielleicht auch tote Frau. Ein Schrei. Schwarz. Dann ein kurzer, so prägnanter wie lakonischer (und schlussendlich ambivalenter) Titelcredit: „Hero Wanted“.
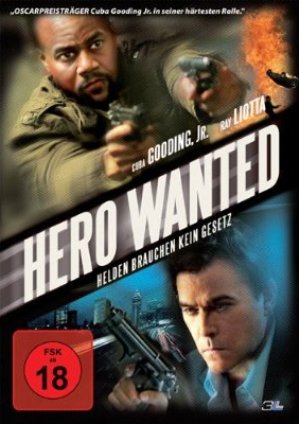 „I really wish we hadn’t started here.“ Wir finden uns in diesen Film geworfen und treffen auf seinen Protagonisten als jemanden, der bereits in einem grundlegenden Danach gefangen ist. Immer schon alles zu spät: Volltrunken in einer Bar, über die Theke kotzend. Augenblickskurze Flashbacks, eine tote Ehefrau, schwanger, gestorben in einem Autounfall. Liam Case (Cuba Gooding, Jr.) erscheint in diesen Momenten wie ein Schlafwandler, der unberührt durch die Ruine seines Lebens streift – bis ihn (und uns) ein ohrenbetäubender Crash aus der Lethargie herausreißt. Erneut ein Autounfall, und ohne einen Augenblick zu zögern, stürzt sich Liam in das brennende Wrack, um ein kleines Mädchen vor dem Flammentod zu retten. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau, so teilt er uns mit, habe er etwas Sinnvolles getan. Ein Leben gerettet, „but not tonight“. Sekunden später sehen wir Liam mit einer Waffe in der Hand, einen Anschlag auf den fröhlich masturbierenden Gangster Lynch McGraw vorbereitend. Wieder ein Schnitt, und das bedeutet hier stets: wieder ein Sprung ins Ungewisse. Nun finden wir Liam in einer Bank wieder, schüchtern mit einer Angestellten flirtend und schließlich in einen eskalierenden Überfall verwickelt. Einer der Bankräuber verliert die Nerven, schießt der jungen Frau in den Kopf, auch Liam, der ihr zu helfen versucht, fängt sich eine Kugel ein. Noch ein Schnitt, Krankenhaus, Liam am Krankenbett der ins Koma gefallenen Bankangestellten. Dann wieder die Waffe: ein Rachefeldzug, erzählt in schlingernden Zeitpirouetten. Den Tod des mit einem Wok brutalst zu Tode geprügelten Lynch sehen wir zunächst nur in seiner Konsequenz, durch die Augen des ermittelnden Polizisten Terry Subcott (Ray Liotta). Dann endlich formieren sich jene grundsätzlich durchaus geradlinigen Bewegungen, die den Plot des ungewöhnlichen Action-B-Movies „Hero Wanted“ über den größeren Teil seiner Laufzeit tragen werden: Subcott sucht, wenngleich wenig leidenschaftlich, den Mörder McGraws, während dessen Bruder Skinner (Kim Coates) Vergeltung sucht – nur um ebenfalls kaltblütig von Case getötet zu werden. Der Konflikt spitzt sich zwischen diesem und dem ebenfalls am Banküberfall beteiligten Psychopathen Derek (Thomas Flannigan) und Liam zu – welche Verbindung jedoch zwischen diesem und den Räubern besteht, welche Rolle sein Freund Swain (Norman Reedus) spielt, und vor allem: in welchem Verhältnis genau nun Heldenmut und kriminelle Umtriebe stehen, das alles wird sich erst im Verlauf des Filmes entwirren.
„I really wish we hadn’t started here.“ Wir finden uns in diesen Film geworfen und treffen auf seinen Protagonisten als jemanden, der bereits in einem grundlegenden Danach gefangen ist. Immer schon alles zu spät: Volltrunken in einer Bar, über die Theke kotzend. Augenblickskurze Flashbacks, eine tote Ehefrau, schwanger, gestorben in einem Autounfall. Liam Case (Cuba Gooding, Jr.) erscheint in diesen Momenten wie ein Schlafwandler, der unberührt durch die Ruine seines Lebens streift – bis ihn (und uns) ein ohrenbetäubender Crash aus der Lethargie herausreißt. Erneut ein Autounfall, und ohne einen Augenblick zu zögern, stürzt sich Liam in das brennende Wrack, um ein kleines Mädchen vor dem Flammentod zu retten. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau, so teilt er uns mit, habe er etwas Sinnvolles getan. Ein Leben gerettet, „but not tonight“. Sekunden später sehen wir Liam mit einer Waffe in der Hand, einen Anschlag auf den fröhlich masturbierenden Gangster Lynch McGraw vorbereitend. Wieder ein Schnitt, und das bedeutet hier stets: wieder ein Sprung ins Ungewisse. Nun finden wir Liam in einer Bank wieder, schüchtern mit einer Angestellten flirtend und schließlich in einen eskalierenden Überfall verwickelt. Einer der Bankräuber verliert die Nerven, schießt der jungen Frau in den Kopf, auch Liam, der ihr zu helfen versucht, fängt sich eine Kugel ein. Noch ein Schnitt, Krankenhaus, Liam am Krankenbett der ins Koma gefallenen Bankangestellten. Dann wieder die Waffe: ein Rachefeldzug, erzählt in schlingernden Zeitpirouetten. Den Tod des mit einem Wok brutalst zu Tode geprügelten Lynch sehen wir zunächst nur in seiner Konsequenz, durch die Augen des ermittelnden Polizisten Terry Subcott (Ray Liotta). Dann endlich formieren sich jene grundsätzlich durchaus geradlinigen Bewegungen, die den Plot des ungewöhnlichen Action-B-Movies „Hero Wanted“ über den größeren Teil seiner Laufzeit tragen werden: Subcott sucht, wenngleich wenig leidenschaftlich, den Mörder McGraws, während dessen Bruder Skinner (Kim Coates) Vergeltung sucht – nur um ebenfalls kaltblütig von Case getötet zu werden. Der Konflikt spitzt sich zwischen diesem und dem ebenfalls am Banküberfall beteiligten Psychopathen Derek (Thomas Flannigan) und Liam zu – welche Verbindung jedoch zwischen diesem und den Räubern besteht, welche Rolle sein Freund Swain (Norman Reedus) spielt, und vor allem: in welchem Verhältnis genau nun Heldenmut und kriminelle Umtriebe stehen, das alles wird sich erst im Verlauf des Filmes entwirren.
„Sometimes, things worth dying for are worth living for.“ Auf den ersten Blick ist „Hero Wanted“, das Regiedebüt des als Second Unit Regisseur und Stuntkoordinator in Hollywoods Größtproduktionen erfahrenen Brian Smrz, auffällig fragmentarisch erzählt. Zwar gelingt es Smrz durchaus, im ersten Filmdrittel eine (ungefähre) Konstellation von (Anti-)Held und Antagonisten zu konstruieren – mit einem seltsam äußerlich anmutenden Nebenplot um den als eindeutiger der Lichtseite zuneigenden Doppelgänger inszenierten Cop Subcott, der sich erst am Ende in das Gesamtsystem des Films einschmiegt –, doch lässt er sich niemals auf einen schnörkellosen Verlauf seiner im Grunde schlichten Narration ein. Tatsächlich scheint sich diese eher festzuhaken an einer Reihe von „unerhörten Begebenheiten“, um jene dann schier manisch zu umkreisen. Diese Erzählweise wirft eher Fragen nach Schuld, Leid, Verlust auf als bloß das Verlangen nach dem nächsten Plot Point – Liam Case ist Mörder und Retter zugleich, ein trauriger Rächer, verflucht gleichermaßen von der Last der guten wie der bösen Tat. Zerrissen zwischen divergierenden Bildern seiner selbst, die stets zu groß für ihn sind. Im Schlussdrittel von „Hero Wanted“ werden sich dann die Verstrickungen aufklären, und spätestens hier wird klar, dass jegliche scheinbare Abschweifung stets nur wieder zu Liam zurückführt, dass tatsächliche das komplette (moralische wie narrative) System des Films ausschließlich um diese eine zentrale Figur herum inszeniert ist. Hierin spiegelt sich die solipsistische Weltwahrnehmung und Handlungsweise dieses Antihelden, und konsequenterweise ereignet sich die katastrophische Eskalation dann auch jeweils durch das Eindringen äußerlicher Faktoren, welche die „simplen Pläne“ Liams – mit unbeholfenen Mitteln das Gute wollend und das Böse schaffend – zum Scheitern bringen. Der vorgetäuschte Banküberfall, der unvermittelt zum „echten“ wird und sehr reale Folgen zeitigt – so ähnlich übrigens, vielleicht ja gar nicht zufällig, eines der Grundmomente in Baudrillards „Agonie des Realen“ –; der scheinbare Mut, der aus der Feigheit geboren ist; der gerettete Lebensretter aus Todessehnsucht: „Hero Wanted“ ist ein hochinteressanter Beitrag zum jüngeren DTV-Actionkino, der sich diesen Widersprüchlichkeiten nicht nur stellt, sondern der sie nachgerade fetischistisch umkreist und sie letztlich zum eigentlichen Motor seiner physischen wie narrativen Bewegungen macht.
Hero Wanted
(USA 2008)
Regie: Brian Smrz; Buch: Chad Law, Evan Law; Musik: Kenneth Burgomaster; Kamera: Larry Blanford; Schnitt: Tim Anderson
Darsteller: Cuba Gooding, Jr., Ray Liotta, Norman Reedus, Kim Coates, Thomas Flannigan, Jean Smart, Christa Campbell, Steven Kozlowski, Ben Cross u.a.
Länge: 91 Min.
Verleih: 3L Filmverleih
Zur DVD von 3L Filmverleih
Der bemerkenswerte Film erscheint in angemessener Bild- und Tonqualität und in ungekürzter Fassung auf DVD. Das Bonusmaterial hat (neben Trailern und einer Bildergalerie) lediglich eine unkommentierte Featurette zu den Dreharbeiten sowie einige sehr kurze Statements der beteiligten Schauspieler und Filmemacher zu bieten.
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch (DTS, Dolby Digital 5.1), Englisch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch
Extras: Hinter den Kulissen, Statements zum Film von Darstellern & Crew, Deutscher Trailer, Originaltrailer, Bildergalerie
FSK: Keine Jugendfreigabe
Viel Plot, wenig Geheimnis
Am Anfang steht das Postkartenpanorama: Charles Bronson ist Joe Martin, Ruheständler an der malerischen Côte d’Azur, und gemeinsam mit ihm und den Eröffnungscredits schippern wir per Boot in diesen Film hinein. „De la part des copains“, wie der Vorspann verrät, oder eben „Kalter Schweiß“ – der deutsche Kinotitel, mit dem der Verleih anno 1970 wohl versuchte, den eher klassisch erzählten Euro-Actioner als knüppelharten Reißer anzupreisen.
RESURRECTION OF THE LITTLE MATCH GIRL
Ju ist ein durschnittlicher Jugendlicher in Korea – etwas orientierungs- wie perspektivenlos verbringt er den Tag mit eher lausigen Jobs und vergeblichem Mädchen-Anbaggern, ansonsten flüchtet er sich, in den bunten, knalligen Spielhallen seiner Stadt, in virtuelle Cyberwelten, wenngleich auch hier mit ebenfalls nur mäßigem Erfolg. Die Risse im eingangs etablierten Realitätsgefüge werden jedoch – zumindest aus unserer Perspektive im Kinosaal – größer. Ju betritt wortwörtlich ein neues Spiel, in dem er, in Anlehnung an das Märchen von Hans Christian Andersen, den Tod des Streichholzmädchens – postmodern versetzt in eine bunte, knallige, urbane Bonbonwelt – gegen mutmaßliche Retter – Freier, Gegner, wer-auch-immer – sicherstellen muss, damit die Geschichte ihren gewohnten, romantisch-melancholischen Gang gehen kann. In späteren Levels dann, wenn nichts mehr an die alte Realität erinnern mag, Ju vollkommen im Cyberkosmos sein Dasein als Player fristet, verschieben sich die Aufgaben zusehends, bis dann im Finale, mit Hilfe anderer Spieler, der Kampf gegen das Spielsystem selbst im Mittelpunkt steht.
„RESURRECTION OF THE LITTLE MATCH GIRL“ weiterlesen

