Ein Essay von Thomas Damberger
Der Einsatz von Filmen ist äußerst vielseitig. Der Film kann als Propagandamittel eingesetzt, als Unterhaltungsmittel verwandt, als Lehrmittel genutzt werden. Die verschiedenen Weisen, in denen uns der Film begegnet, sind eng verwoben mit seiner technischen Gestaltung, mit der Idee, welche im Film währt, mit der Bedeutung, die in den Film hineingelegt wird und durch seine Ausgestaltung zum Ausdruck kommen soll. Zugleich spielt das Verhältnis des Zuschauers zum Film für dessen Ankommen, dessen Wirken, eine wesentliche Rolle, was unweigerlich zu der Frage führt, wie wir einen Film wahrnehmen, was im Zuge der Wahrnehmung eines Films in uns und in unserem Verhältnis zum Film wirkt.
Der vorliegende Text befasst sich sowohl mit den innerfilmischen Momenten, in besonderer Weise aber mit dem Verhältnis von Zuschauer und Film, dabei sind die Überlegungen von dem Versuch getragen, beide Momente sowohl einzeln zu betrachten und zu analysieren, als auch ihre untrennbare Verwobenheit hervorzuheben und als wesentlich für die Ermöglichung von Reflexion in Bezug auf den Film, als auch zur Vermeidung derselben zu kennzeichnen.
Die Vorgehensweise wird folgendermaßen sein: Zu Beginn erden allgemeine Überlegungen zur Wahrnehmung von Dingen, so, wie sie insbesondere (aber nicht ausschließlich) von Vertretern der Phänomenologie und des französischen Existenzialismus angeführt werden, vorgestellt und durchdacht. Im weiteren Verlauf werden diese dann sowohl auf die (inner-)filmische Gestaltung, als auch auf das Verhältnis des Zuschauers zum Film übertragen. Zuletzt wird die Verwobenheit von Filmgestaltung und Filmwirkung hervorgehoben, wobei eine eigentümliche Dialektik zutage tritt, die sich als konstitutiv für das Verhältnis von Film und Reflexion erweisen wird.
Weisen der Erfahrung
Die Wahrnehmung der Dinge
Maurice Merleau-Ponty nimmt in seinem philosophischen Essay „Das Kino und die neue Psychologie“ eine grundsätzliche Differenzierung zwischen dem vor, was er als die klassische Psychologie bezeichnet und der von ihm so genannten neuen Psychologie.
Die klassische Psychologie geht – so Merleau-Ponty – von einer Trennung von Empfundenem und Gedachtem aus. Den Würfel, der auf dem Tisch steht und den ich betrachte, sehe ich im eigentlichen Sinne nicht als Würfel, sondern „als eine perspektivische Figur, deren Seitenflächen verzerrt sind und deren Rückseite vollkommen verborgen ist“[1]. Aus Sicht der klassischen Psychologie begegnet mir der Würfel demnach erst einmal als diese perspektivische Figur; zum Würfel wird die Figur dann quasi in einem zweiten Schritt und zwar durch eine „Operation der Intelligenz“, in deren Folge ich „eine Einheit des Wahrnehmungsfeldes“[2] schaffe. Kurzum: Ich denke mir das, was ich nicht sehe, hinzu und erschaffe bzw. konstruiere mir den Würfel, den ich als solchen nicht sehe. Die neue Psychologie hingegen, so der französische Phänomenologe, lehnt die besagte Trennung zwischen Empfundenem und Gedachtem entschieden ab. Das Ding, welches ich in seiner einzigartigen Weise des Existierens erfasse, spricht nicht nur mehrere meiner Sinne zugleich an. Ich nehme es vielmehr in einer bestimmten Weise wahr, nämlich schlicht und ergreifend so, wie es mir erscheint. Bleiben wir beim Beispiel des Würfels. Wenn ich einen vor mir liegenden Würfel betrachte, ihn also noch nicht berührt, noch nicht in meiner Hand gedreht und analysiert habe, so kann ich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es sich beim Würfel möglicherweise gar nicht um einen solchen handelt. Es könnte wahrlich nur ein Gegenstand sein, der aus nur eben den drei Seiten besteht, die ich just in diesem Moment sehe. Ich könnte auch die – wenngleich unwahrscheinliche – Möglichkeit anführen, dass es sich bei dem Würfel um ein Hologramm handelt, durch das ich hindurch greifen könnte. All dies ist möglich, nichtsdestotrotz spielen diese Möglichkeiten bei meinem Blick auf den Würfel keine wesentliche Rolle. Merleau-Ponty würde sagen, dass die Rolle nicht einmal unwesentlich ist, sie ist gar nicht vorhanden. Nicht nur „bemerke ich nicht einmal die perspektivische Deformation; quer zu dem, was ich sehe, verhalte ich mich zu dem Würfel selbst in seiner Evidenz.“[3].
Dieser Modus der spontanen Wahrnehmung, welcher jenseits der Trennung von Denken und Empfinden liegt, ist nicht nur auf Dinge im Sinne von bloßen Gegenständen zu beziehen, sondern darüber hinaus auch auf Menschen, wie sie uns als In-der-Welt-Seiende und somit als Ding unter Dingen erscheinen. Wenn mir eine Person begegnet, die in einer Weise gestimmt ist, die ich als zornig bezeichnen würde, so kann ich versuchen, dieses Zornig-Sein anhand von physiologischen Expressionen zu messen. Ich kann die Pulsfrequenz, die Atemfrequenz und die Höhe des Blutdrucks messen, darüber hinaus den Wert des Adrenalins im Blut usf. Ich könnte eine Tabelle ähnlich einer Messleiste erstellen, in die ich meine ermittelten Werte eintrage, um am Ende behaupten und freilich auch quantitativ belegen zu können, dass es sich bei dem zornigen Menschen um einen leicht zornigen, mittelmäßig erzürnten oder um einen im hohen Maße zornigen Zeitgenossen handelt. All dies kann ich vornehmen, und dennoch wüsste ich am Ende nichts über den Zorn dieses Menschen. Ich wüsste seine Atemfrequenz, seinen Blutdruck und seinen Adrenalinwert, und ich bezöge dies auf einen innerpsychischen Empfindungszustand (den ich letztlich doch nur unterstellen würde). Das, was der Zorn, gleichwie jede andere Emotion ist, erweist sich nicht als „psychische und innere Tatsache […], sondern [als] eine Veränderung unserer Beziehung zum Anderen und zur Welt, die [an] unserer Körperhaltung ablesbar ist“[4]. Wichtig ist, dass ich aufgrund der Weise, wie mir der Andere erscheint, keinesfalls darauf schließen kann, wie der Andere empfindet. Hierüber kann ich keine Auskunft erhalten, ich kann lediglich wahrnehmen, wie die Weise des Erscheinens des Anderen auf mich wirkt.
Von Nähe und Distanz
Die Veränderung unserer Beziehung zum Anderen ist also gebunden an den Modus unserer Wahrnehmung. Nun hat die Veränderung innerhalb einer jeden Beziehung sehr viel mit dem Verhältnis von Nähe und Distanz tun. Stellen wir uns die Situation vor, in der ein Mann und eine Frau miteinander verabredet sind. Die beiden kennen sich noch nicht sonderlich lange, und wenngleich zwischen den beiden eine gewisse Sympathie und wohl auch eine gegenseitige Anziehung nicht zu leugnen ist, sind sich die beiden zu Beginn des Treffens alles andere als nahe. Die beiden sitzen nebeneinander auf einem Sofa und beginnen mit einer Unterhaltung, die mit Alltäglichem beginnt und, so erscheint es dem Mann, nicht recht über den Austausch von Banalitäten hinausgehen will.
Je mehr die Frau, die sich als deutlich extrovertierter erweist, vor sich hin spricht, desto größer erscheint dem Mann die Kluft zwischen den beiden. Um dieses Gefühl des voneinander Entfernens zu mindern, schlägt der Mann vor, eine Passage aus einem Buch vorzulesen, die er für sehr tief, sehr bedeutsam erachtet und von der er glaubt, die Frau könnte sich dafür interessieren. So zumindest scheint es, denn die Frau bietet bei der Erwähnung des Titels sogar freimütig an, selbst vorzulesen. Während die Frau liest beobachtet sie der Mann. Ihm fällt die eigentümliche Bewegung ihrer Lippen auf, die Art, wie sie sich mit ihrer rechten Hand die Haare immer wieder hinter das Ohr streift. Da ist die Monotonie ihrer Stimme, die ihm wie eine Disharmonie zur Melodie des Textes erscheint, das nervöse Wippen ihrer Beine etc. Die Entfernung zu ihr bleibt.
Im Verlauf des Abends gibt es einige Veränderungen. Wie durch Zufall bewegen die beiden mehrere Male ihre Hände so, dass sie aneinander stoßen. Als sie näher zusammenrücken, um gemeinsam eine Zeichnung zu betrachten, spürt der Mann, wie die Frau sich etwas fester, als es nötig gewesen wäre, an ihn drückt. Im weiteren Verlauf der Verabredung kommt es zu der Situation, dass die Blicke von Mann und Frau sich in einem Moment treffen, in dem die Gesichter der beiden nur unmerklich voneinander entfernt sind. Im gegenseitigen Anblicken und Erblickt-werden fühlt der Mann die Entfernung zur Frau zusehends schwinden. Der Blick dauert einige Zeit an, ohne dass einer der beiden Anzeichen macht, die Distanz zwischen den Gesichtern zu verändert. Dennoch fallen mit jeder Sekunde ganze Welten, die sich im Laufe des Abends zwischen den beiden aufgetan haben, um zeitweise wieder zu verschwinden, um dann doch erneut wieder aufzutauchen. Es kommt zum Kuss, ein Vorgang, der eigentlich nicht viel mehr ist, als ein Aufeinanderstoßen zweier feuchter Mundenden, der aber dennoch für den Mann einer Ahnung des Gefühls des Verschmelzens gleichkommt: ein Wille, der die Verschmelzung will, und zugleich weiß, dass die Verschmelzung das Ende seines Wollens wäre.
Was aber nun macht diese Veränderung innerhalb des Verhältnisses von Nähe und Distanz zwischen diesen beiden Menschen aus? Einerseits ist es zweifellos so, dass die Entfernung zwischen Mann und Frau während der Unterhaltung eine andere ist, als im Moment des Küssens. Diese Entfernung ist auch für Dritte ohne weiteres feststellbar, doch geht es ganz offenbar nicht um diese (objektiv) messbare Entfernung. So erscheint es doch als seltsam, dass selbst dann, wenn der Mann sich an einem bestimmten Punkt im Raum befindet, er sozusagen feststeht (bzw. festsitzt), die Distanz zwischen den beiden dennoch einer Veränderung unterliegt. Diese Veränderung kann durch Worte, Erinnerungen, Wünsche, Gerüche, die Assoziationen hervorrufen usf. geschehen. Ein Lächeln der Frau in einem Augenblick, in dem der Mann seine eigene Freude in den Augen der Frau gespiegelt sehen will, erzeugt Nähe; ein sich abwendender Blick respektive ein Blick, der durch einen hindurch zu gehen scheint, kann das Gefühl des Nicht-gesehen-werdens oder Nicht-gesehen-werden-wollens vermitteln und schafft dadurch Distanz. Merleau-Ponty schreibt in seiner „Phänomenologie der Wahrnehmung“: „Neben dem zwischen mir und allen Dingen bestehenden physischen und geometrischen Abstand verbindet ein erlebter Abstand mich den Dingen, die für mich zählen und existieren, und verbindet sie untereinander. Dieser Abstand ist von Augenblick zu Augenblick das Maß und die `Weite` meines Lebens.“[5]. Der erlebte Abstand, von dem Merleau-Ponty spricht, hängt nicht den Dingen insofern an, als dass eine bestimmte Anordnung im Raum ihre Entfernung zueinander konstituiert. Im Gegenteil ist die Distanz und die Veränderung derselben eng mit mir und mit allem, was mich ausmacht, verbunden. Genauer: Nähe und Distanz zu einem Menschen, einem Gegenstand, kurzum: einem Ding in der Welt entspringen aus mir heraus. Zugleich aber, und dies scheint die Freiheit, die man hierin erahnen könnte zu trüben, bin ich unvermögens, über das, was aus mir Selbst entspringt, zu verfügen. Mit anderen Worten: Ich kann die Nähe oder die Entfernung nicht selbst machen. Dies ist aus zwei Gründen heraus nicht möglich. Einerseits scheitert meine Freiheit im Sinne einer Verfügbarkeit an der Freiheit des Anderen – dies ist ein Aspekt, der im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch näher interessieren wird. Andererseits ist die Verfügbarkeit über die eigene Person bzw. über das, was der eigenen Person entspringt, unmittelbar an zwei vorhergehende Momente der Unverfügbarkeit gebunden und vermag erst in einem dritten Schritt in den eigenen Verfügungsbereich empor gehoben werden.
Transitiv, intransitiv, reflexiv…, und die Freiheit zur Entscheidung
Um diesen noch recht diffus anmutenden Gedanken zu konkretisieren, erweisen sich die Überlegungen des Pädagogen Werner Sesink als hilfreich. Sesink betrachtet den Bildungsbegriff als einen mehrdimensionalen, bestehend aus einem intransitiven Moment, das als eine von Spontaneität getragene, nach außen drängende Bewegung zu verstehen ist. Weder bin ich mir über diese Kraft, die in mir währt und wirkt bewusst, noch mache ich sie. Es geschieht in und mit mir, ohne dass ich als Verfügender dem zugrunde liege. Die zweite dem Bildungsbegriff immanente Dimension ist eine transitive. Von außen wird etwas an den Menschen herangetragen, etwas geht über (oder soll übergehen). Der Bildner bildet den Zu-Bildenden.
 Aus der Sicht des Zu-Bildenden wirkt etwas von außen auf ihn ein. Diese Einwirkung stellt einen Widerstand dar. Das, was als intransitives Moment nach außen hin drängt, stößt auf ein In-der-Welt-Seiendes. Wir haben es also sowohl beim Intransitiven, als auch beim Transitiven mit unverfügbaren, ja, man könnte sogar behaupten: fremdbestimmten Momenten zu tun. Nun ist aber der Bildungsbegriff unweigerlich mit der Selbstbestimmung verwoben. Sesink formuliert dies folgendermaßen: „Bildung nenne ich den selbstbestimmten Anteil an der Entwicklung eines Menschen aus seinem eigenen Sinn.“[6]; er erinnert dabei ganz explizit an den Bildungstheoretiker Heinz-Joachim Heydorn, der „Bildung begreift […] als [eine] entbundene Selbsttätigkeit […]. Mit ihr begreift sich der Mensch als sein eigener Urheber!“[7]. Hier scheint sie wieder aufzutauchen, die Freiheit. Wie aber ist das möglich? Wie kann aus zwei fremdbestimmten Momenten die Selbstbestimmung hervorgehen? Dies geschieht nach Sesink im Zuge der Reflexion. Versuchen wir dies am o. a. Beispiel der Mann-Frau-Beziehung zu erläutern.
Aus der Sicht des Zu-Bildenden wirkt etwas von außen auf ihn ein. Diese Einwirkung stellt einen Widerstand dar. Das, was als intransitives Moment nach außen hin drängt, stößt auf ein In-der-Welt-Seiendes. Wir haben es also sowohl beim Intransitiven, als auch beim Transitiven mit unverfügbaren, ja, man könnte sogar behaupten: fremdbestimmten Momenten zu tun. Nun ist aber der Bildungsbegriff unweigerlich mit der Selbstbestimmung verwoben. Sesink formuliert dies folgendermaßen: „Bildung nenne ich den selbstbestimmten Anteil an der Entwicklung eines Menschen aus seinem eigenen Sinn.“[6]; er erinnert dabei ganz explizit an den Bildungstheoretiker Heinz-Joachim Heydorn, der „Bildung begreift […] als [eine] entbundene Selbsttätigkeit […]. Mit ihr begreift sich der Mensch als sein eigener Urheber!“[7]. Hier scheint sie wieder aufzutauchen, die Freiheit. Wie aber ist das möglich? Wie kann aus zwei fremdbestimmten Momenten die Selbstbestimmung hervorgehen? Dies geschieht nach Sesink im Zuge der Reflexion. Versuchen wir dies am o. a. Beispiel der Mann-Frau-Beziehung zu erläutern.
Das dem Mann entgegengebrachte und von ihm wahrgenommene Lächeln bedeutet ihm etwas. Dass er dem Lächeln eine Bedeutung zugesteht, lässt auf eine vorgängige Bewegung schließen. Diese intransitive Bewegung geschieht in ihm und ist gerichtet auf das Außen, drängt also aus ihn heraus in die Welt. Er will, dass die Frau ihn will – so könnte man diesen Drang benennen. Da ihm nun aber die Intransitivität der Bewegung – oder seien wir konkreter: des Wollens – noch nicht bewusst ist, kann er das Wollen allein jetzt, also sozusagen rückläufig als ein solches ausmachen. Als intransitive Bewegung ist ihm das Wollen als Wollen unbewusst. Nun trifft diese Bewegung auf die Welt. Die Welt ist für ihn in dieser Situation die Frau, die ihn ansieht und ihm zulächelt. Sein Wollen des Wollens trifft auf die lächelnde Frau, die ihm so das eigene Wollen zurückwirft. In diesem Moment des Zurückbeugens seines eigenen Drangs empfindet er etwas, und das, was er empfindet, ist eine Verminderung der Distanz zwischen ihm und der Frau. Er kommt ihr näher. Warum aber kommt er ihr näher? Hängt dies allein mit der Frau zusammen? Nun, eigentlich nur bedingt, denn das, was ihm die Frau in dieser Situation ist, gleicht im eigentlichen Sinne einem Spiegel. Sie wirft ihm als In-der-Welt-Seiende sein eigenes Wollen, seine Bewegung hin zur Welt zurück. Sie bestätigt ihm sein Wollen, dass sie ihn will. Die Nähe, die er in diesem Moment empfindet, ist daher m. E. nicht im eigentlichen Sinne eine Nähe zu ihr als Person, sondern es ist eine Nähe zu ihr als Spiegel, genauer: eine Nähe zu ihm als von ihm selbst Getrennter und ihn zugleich wieder Einholender. Dieses Getrenntsein von ihm selbst ist – gleichwie das Einholen seiner selbst – allein als Folge eines analytischen Vorgehens zu verstehen. Er kann jetzt, da er das, was geschehen ist, gedanklich zerlegt, sein Wollen beschreiben. Als intransitive Bewegung ist ihm in der Situation sein Wollen nicht bewusst; durch den Widerstand der Welt, durch das Zurückwerfen seines Wollens, dass sie ihn will, wird ihm sein eigenes Wollen bewusst. Dann hat er es vor sich, dann ist er ein von seinem Wollen Getrennter, der aber in der Situation, wenngleich er sich sein Wollen vor-stellt, doch zugleich immer auch der Wollende ist. Das Verhalten zu seinem Wollen stellt nun das Moment der Freiheit dar, welches doch zugleich das Wollen selbst nicht berührt. Er kann nun, da er zu erkennen meint, dass sein Wollen sich selbst will, aber die Frau (vielleicht sogar genau und ausschließlich diese Frau) als Spiegel braucht, um sein Verhalten zum eigenen Wollen möglich zu machen, sich gegen dieses Wollen entscheiden, doch bleibt davon das Wollen selbst unberührt. Allein er entwirft sich zu dem, der sein Wollen nicht will.[8]
Weisen der Gestaltung
Der Raum und das Dazwischen
Wenn wir unser Augenmerk nun auf den Raum richten, so entbirgt sich bei unserem Blick auf das, was einen Raum auszeichnet, eine eigentümliche Dialektik. Wenn ich mir den Raum betrachte, in dem ich jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, sitze, so besteht dieser aus vier Wänden, die eine Begrenzung des Raums darstellen.
 Es gibt ein Draußen und ein Drinnen. Im Raum sitze ich, und wenn ich einen Blick aus dem Fenster wage und die Bäume betrachte, die von den Windböen hin und her gerissen werden, wenn ich das Geräusch der schweren Regentropfen vernehme, die vereinzelt gegen die Scheiben schlagen, dann kann ich wohl behaupten, dass die Wände mir Schutz bieten, indem sie die Welt um mich herum zurückhalten. Auf der anderen Seite ermöglichen sie mir auf diese Weise (Frei-)Raum, den ich nutzen, den ich ausfüllen, den ich gestalten kann. Würde der Raum, der durch den zurückhaltenden Charakter der umgebenden Wände entsteht, gänzlich ausgefüllt werden, so wäre der gewonnene (Frei-)Raum wieder verloren. Also erscheint die Leere zwischen den Dingen, zwischen den Wänden aber auch zwischen den im Raum angeordneten Gegenständen als für den Raum konstitutiv. Sesink verweist in einem ähnlichen Zusammenhang auf die im englischen Sprachgebrauch übliche Differenzierung von „room“ und „space“[9]. Während mit „room“ in der Regel architektonische Räume bezeichnet werden, meint die Bezeichnung „space“ vielmehr den Zwischenraum, die Leere zwischen den Dingen. So spricht man im Englischen von Bathroom, von Bedroom, von Cyberspace etc. Im Deutschen verzichten wir auf diese Differenzierung. Wir verwenden allein die Bezeichnung Raum und tun dies sowohl beim Schlafraum, als auch beim Weltraum oder beim virtuellen Raum. Dennoch spielen dann, wenn wir vom Raum sprechen, beide Momente, sowohl das Architektonische, als auch die Leere dazwischen eine wesentliche Rolle. „[S]pace gibt es nur im room“[10]; von der Leere oder einem Dazwischen kann ich nur dann sprechen, wenn es etwas gibt, was dieses Dazwischen möglich macht. Hier rückt also der gestalterische Aspekt in den Vordergrund. Einen gewonnenen Raum bis obenhin mit allem Erdenklichen voll zu stopfen würde die Eliminierung der Leere bedeuten und ein wesentliches Moment des Raumes vernachlässigen, somit also den Raum selbst verunmöglichen.
Es gibt ein Draußen und ein Drinnen. Im Raum sitze ich, und wenn ich einen Blick aus dem Fenster wage und die Bäume betrachte, die von den Windböen hin und her gerissen werden, wenn ich das Geräusch der schweren Regentropfen vernehme, die vereinzelt gegen die Scheiben schlagen, dann kann ich wohl behaupten, dass die Wände mir Schutz bieten, indem sie die Welt um mich herum zurückhalten. Auf der anderen Seite ermöglichen sie mir auf diese Weise (Frei-)Raum, den ich nutzen, den ich ausfüllen, den ich gestalten kann. Würde der Raum, der durch den zurückhaltenden Charakter der umgebenden Wände entsteht, gänzlich ausgefüllt werden, so wäre der gewonnene (Frei-)Raum wieder verloren. Also erscheint die Leere zwischen den Dingen, zwischen den Wänden aber auch zwischen den im Raum angeordneten Gegenständen als für den Raum konstitutiv. Sesink verweist in einem ähnlichen Zusammenhang auf die im englischen Sprachgebrauch übliche Differenzierung von „room“ und „space“[9]. Während mit „room“ in der Regel architektonische Räume bezeichnet werden, meint die Bezeichnung „space“ vielmehr den Zwischenraum, die Leere zwischen den Dingen. So spricht man im Englischen von Bathroom, von Bedroom, von Cyberspace etc. Im Deutschen verzichten wir auf diese Differenzierung. Wir verwenden allein die Bezeichnung Raum und tun dies sowohl beim Schlafraum, als auch beim Weltraum oder beim virtuellen Raum. Dennoch spielen dann, wenn wir vom Raum sprechen, beide Momente, sowohl das Architektonische, als auch die Leere dazwischen eine wesentliche Rolle. „[S]pace gibt es nur im room“[10]; von der Leere oder einem Dazwischen kann ich nur dann sprechen, wenn es etwas gibt, was dieses Dazwischen möglich macht. Hier rückt also der gestalterische Aspekt in den Vordergrund. Einen gewonnenen Raum bis obenhin mit allem Erdenklichen voll zu stopfen würde die Eliminierung der Leere bedeuten und ein wesentliches Moment des Raumes vernachlässigen, somit also den Raum selbst verunmöglichen.
Wenn aber die Anordnung der Dinge im Raum entscheidend für den Raum als solchen sind, dann ist dies der richtige Zeitpunkt, um mit Merleau-Ponty nun den Bogen hin zum Film zu schlagen. So schreibt dieser in „Das Kino und die neue Psychologie“: „Die Ideen und Handlungen sind nur Material für die Kunst, und die Kunst […] besteht in der Auswahl dessen, was gesagt und was verschwiegen wird […].“[11]. Das Auswählen und Anordnen, das Füllen und Platz-lassen wird in diesem Zitat als wesentlich für die Kunst erachtet. Nun haben wir in unseren bisherigen Überlegungen bemerkt, dass es drei bedeutsame, für den Raum konstitutive Momente gibt. Zum einen ist dies die Begrenzung nach außen hin, folglich also die Ermöglichung eines Innen. Zum zweiten erweist es sich als notwendige Bedingung, dass zwischen den Dingen ein Freiraum, eine Leere, die unausgefüllt bleiben muss, vorherrscht. Das dritte entscheidende Moment ist die Auswahl der Anordnung des Materials. Interessant hierbei ist m. E. die völlige Verabschiedung von der gewohnten „klassischen“ Mehrdimensionalität des Raumes. Wenn wir einen Punkt als eindimensional bezeichnen, einer Fläche hingegen schon zwei Dimensionen zugestehen, so sind wir dann, wenn wir von drei Dimensionen sprechen, beim Raum angekommen. Diese Dreidimensionalität bleibt, so scheint es zumindest, gänzlich unberücksichtigt, wenn wir unsere bisherigen Überlegungen zum Raum bedenken. Der Frage, ob die Marginalisierung der Mehrdimensionalität zulässig ist, soll in diesem Text nicht explizit nachgegangen werden. Auffallend ist es jedenfalls, wie wenig Beachtung dieser Aspekt in unserem Sprachgebrauch findet. Nicht nur sprechen wir von virtuellen Räumen und meinen damit nicht lediglich die Simulation eines realen Raums, den wir mit einem Avatar „begehen“ können, sondern auch Online-Foren, die Raum bieten für eigene Gedanken, Meinungen, Anregungen etc., wir sprechen ebenso unbefangen von Zeiträumen. Wenn wir die weiter oben erarbeiteten bezeichnenden Momente für einen Raum heranziehen, so können wir im Falle eines Buches zweifellos von einem Raum sprechen. Es gibt eine Begrenzung, die das Buch vom Nicht-Buch abgrenzt, es gibt eine Idee, eine Handlung, die den Inhalt des Buches ausmacht und es gibt – und das wäre nach Merleau-Ponty die Kunst – eine Auswahl zwischen dem, was von der tragenden Idee niedergeschrieben wird und dem, was ganz bewusst (zum Wohle, nicht zum Schaden der Idee) verschwiegen wird. Eben diese Aspekte finden sich auch im Film wieder.
Zur Filmkomposition, oder: die Kunst der richtigen Wahl
Beginnen wir mit kleinen Schritten: Wenn wir versuchen, den Film auch als eben solch einen Raum zu betrachten, so geschieht die Anordnung der Dinge innerhalb des Films in einer besonderen Weise. Während wir es beim Bild, ähnlich wie in der Musik, mit einer Komposition von dargestellten Gegenständen zu haben, die es ermöglicht (oder ermöglichen soll) hierin einen Sinn zu vernehmen, ist die Komposition des Filmes von einem besonderen Rhythmus getragen, der gerade auch durch die Technik bedingt ist. Wir haben weiter oben Überlegungen zum Modus der spontanen Wahrnehmung angestellt, bei der es keine explizite Trennung zwischen Empfundenem und Gedachtem gibt. In diesem Kontext haben wir uns des Würfels als Beispiel bedient. Ähnlich, wie im Falle der Fotografie der Betrachter auf das angewiesen ist, was uns das Foto bzw. der Fotograf zeigt, verhält es sich beim Film. Ich kann eine Person im Profil filmen, von unten gegen das Licht, von vorne usw., dabei liegt die Vermutung nahe, dass die Person jedes Mal anders auf den Zuschauer wirken wird. Entscheidend ist es, das für den jeweiligen Filmmoment, für die jeweilige Situation im Film Bedeutsame zur Geltung zu bringen.
Ähnlich wie Merleau-Ponty die Auswahl und Anordnung des Materials als Kunst bezeichnet, sieht auch Arnheim in der Darstellung des für den jeweiligen Moment Wesentlichen ein künstlerisches Moment. Arnheim formuliert dies wie folgt: „Man darf aber trotzdem wohl sagen, dass die Aufgabe, das Charakteristische der Form eines Gegenstandes mit Hilfe eines bestimmten Darstellungsmaterials zum Ausdruck zu bringen, eine wenn auch primitive, so doch künstlerische Aufgabe ist.“[12].
Nun ist aber das, was in einem bestimmten Moment innerhalb einer Szene dargestellt wird, nicht losgelöst vom Rest zu sehen respektive zu verstehen. In dieser Aussage liegt nun freilich keine besondere Tiefe. Wir können eine Sache (oder auch einen Sachverhalt) allein dann sinnvoll einordnen, wenn wir das Drumherum kennen, folglich also Bezüge, Abgrenzungen, Verbindungen herzustellen in der Lage sind. Im Film aber hat eben dieser Aspekt eine ganz besondere Qualität, und deutlich wird dies, wenn wir die technischen Möglichkeiten betrachten, derer sich der Filmemacher bedienen kann, wenn er den Film als Medium nutzt, um einen Sinn, eine Idee zu transportieren. So bietet der Film die Möglichkeit, Handlungsverläufe durch Schnitte zu zerteilen und neu zusammenzusetzen. Die Geschwindigkeit, in der eine Szene gezeigt wird, kann verändert werden, um beispielsweise eine besondere Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Moment zu erzeugen. Zeitlich parallel verlaufende Handlungsstränge, die an gänzlich unterschiedlichen Orten spielen, können gleichzeitig (durch Teilung oder Viertelung des Bildes) oder auch hintereinander gezeigt werden. Interessant ist hierbei, dass wir als Zuschauer die in der Regel häufig auftretenden Zeit- und Ortswechsel nicht als belastend empfinden, sondern vielmehr gelassen, ja ohne nennenswerte Irritationen zulassen. Diese Hinnahme einer uns im realen Leben gänzlich fremden, eigentlich fragmentarischen Darstellungsform erscheint nachdenkenswert. Es erweist sich daher als sinnvoll, sich der Frage zuzuwenden, ob die im Film präsentierte Zerstückelung von Zeit und Raum uns wirklich gänzlich fremd ist.
So vertritt Arnheim in seinem 1965 erschienenen Aufsatz „Kunst heute und der Film“ die Auffassung, dass: „[d]ie Zerstörung der Kontinuität von Raum und Zeit […] ein Alptraum [ist], wenn sie auf die physische Welt angewendet wird, aber sie ist eine vernünftige Ordnung im Reich des Geistes. Tatsächlich lagert der menschliche Geist Erfahrungen der Vergangenheit als Gedächtnisspuren, und in einem Lagergewölbe gibt es keine Zeit-Sequenz oder räumliche Verbindung, nur Affinitäten und Assoziationen, die auf Ähnlichkeit oder Kontrast beruhen.“[13]. Mit anderen Worten: Der Film spiegelt uns eine Weise unseres Denkens, Empfindens und Erinnerns wider, demzufolge wir im Film etwas von uns selbst wieder erkennen.
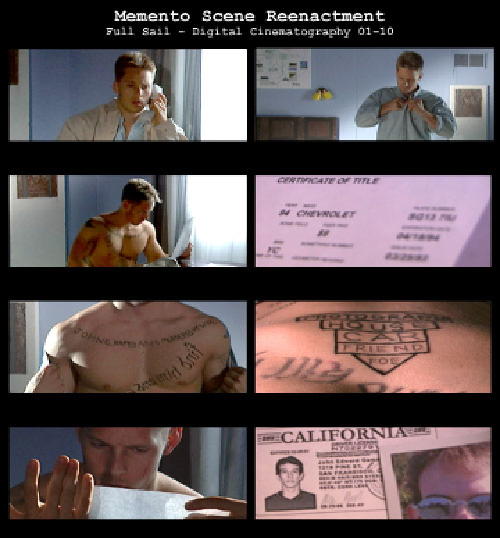 Die fragmentarisch anmutende Zerstückelung von Zeit und Raum, von Handlungssträngen usf. verweist auf eine Verbindung. Diese Verbindung mag dem Film immanent sein, insofern, als der Filmemacher durch die Auswahl und Anordnung dessen, was er wann und wie zeigt und was er bewusst nicht zeigt, demnach als Freiraum für eigenes Denken, eigenes Schaffen von Verbindungen, eigenes Assoziieren offen lässt, die Fragmente verbindet und ihnen Sinn und Bedeutung verleiht. „Die Idee […] taucht auf aus der zeitlichen Struktur des Films wie in einem Gemälde aus der Koexistenz seiner Teile. Das Glück der Kunst ist zu zeigen, wie etwas eine Bedeutung anzunehmen beginnt, und zwar nicht durch Anspielung auf bereits entwickelte und erworbene Ideen, sondern durch die zeitliche oder räumliche Anordnung der Elemente.“[14]. Die zeitliche und räumliche Anordnung von Elementen innerhalb des Films ermöglicht Bedeutung. Unklar allerdings bleibt hierbei, ob die Bedeutung allein durch die Filmkomposition in den Film quasi hineingelegt wird und vom Zuschauer wahrgenommen werden muss, oder ob dieser die Bedeutung selbst generiert.
Die fragmentarisch anmutende Zerstückelung von Zeit und Raum, von Handlungssträngen usf. verweist auf eine Verbindung. Diese Verbindung mag dem Film immanent sein, insofern, als der Filmemacher durch die Auswahl und Anordnung dessen, was er wann und wie zeigt und was er bewusst nicht zeigt, demnach als Freiraum für eigenes Denken, eigenes Schaffen von Verbindungen, eigenes Assoziieren offen lässt, die Fragmente verbindet und ihnen Sinn und Bedeutung verleiht. „Die Idee […] taucht auf aus der zeitlichen Struktur des Films wie in einem Gemälde aus der Koexistenz seiner Teile. Das Glück der Kunst ist zu zeigen, wie etwas eine Bedeutung anzunehmen beginnt, und zwar nicht durch Anspielung auf bereits entwickelte und erworbene Ideen, sondern durch die zeitliche oder räumliche Anordnung der Elemente.“[14]. Die zeitliche und räumliche Anordnung von Elementen innerhalb des Films ermöglicht Bedeutung. Unklar allerdings bleibt hierbei, ob die Bedeutung allein durch die Filmkomposition in den Film quasi hineingelegt wird und vom Zuschauer wahrgenommen werden muss, oder ob dieser die Bedeutung selbst generiert.
Sinn und Bedeutung
Wenn wir davon ausgehen, dass die Leere zwischen den Dingen für das Ganze ebenso konstitutiv ist, wie die Dinge selbst, so ist das, was im Film nicht gezeigt wird, so ist die Lücke zwischen den Zeit- und Ortsprüngen für das Verständnis des Sinns (des Films) essentiell. Beides, das Dargestellte und die Leere dazwischen wird wahrgenommen, doch wäre es fatal eine Entscheidung zu treffen, ob Sinn und Bedeutung des Filmes einfach nur wahrgenommen oder generiert werden, denn eine solche Entscheidung würde die Dialektik verkennen, die im Begriff der Wahrnehmung währt. Gerhard Danzer bringt diese Dialektik der Wahrnehmung auf den Punkt, wenn er in seiner Einführung in das Werk Merleau-Pontys schreibt: „Wahrnehmendes Bewusstsein und wahrgenommene Welt zusammen ergeben Ordnung und Sinn, ohne dass einem der beiden der Primat des Dominierenden zufiele. Das Bewusstsein kippt nicht Sinn und Bedeutung über das Wahrgenommene und rührt diese dann der Welt unter; vielmehr wird partieller, der Welt innewohnender und sich spontan organisierender Sinn wahrgenommen, ergänzt und gesteigert.“[15].
Deutlich ist hierbei die Nähe des Zuschauers zum Film, welches in der dialektischen Verschränkung von „sehen“ und generieren von Sinn offenbar wird. Der slowenische Philosoph und Psychoanalytiker Slavoj Žižek bietet ein anderes Verhältnis von Film und Zuschauer an, das sich im Wesentlichen durch eine größere Distanz auszeichnet, in gewisser Weise die Bande zwischen den beiden Polen zerschlägt. Wie diese Alternative denkbar ist, wird im Folgenden dargestellt werden.
 Žižek erinnert an die Chöre des antiken Theaters, denen er eine besondere, mediale Rolle zugesteht, und dies in zweierlei Hinsicht. Einerseits schaffen sie eine Stimmung, in die sich der Besucher, der von den Erfahrungen und Erlebnissen des alltäglichen Lebens verstimmt ist, hinein versetzen kann. Ja, sie sind vermögens, ihn förmlich in diese Stimmung hineinzuziehen. Dies nun ermöglicht eine bessere Vermittlungsweise dessen, was im Theater währt, was an Sinn und Bedeutung den Besucher erreichen soll. Andererseits sind die Chöre insofern Medium, als dass sie dem Besucher die Mühe abnehmen, sich in eine besondere Stimmung zu schicken. Die Chöre sind bereits die Stimmung, der Besucher kann sich zurück lehnen und das Geschehen beobachten[16]. Žižek erinnert, um diese Überlegung verständlich werden zu lassen, an den Warenfetischismus, wie ihn Marx dargelegt hat, unterzieht ihn aber einer (seiner) besonderen Leseart. So zeichnen sich im vorindustriellen feudalen System die Beziehungen zwischen den Menschen durch eine Verwobenheit „ideologischen Glaubens und Aberglaubens“[17] aus. Im Zuge der industriellen Revolution wurde die Freiheit des Menschen zusehends bedeutsamer. Das kapitalistische System braucht den Vertragspartner, der formal mündig und frei über sich und seine Arbeitskraft verfügen kann. Die Beziehung, die sich im Verlauf der Industrialisierung zwischen den Menschen konstituiert, geschieht mittelbar – und zwar durch die ihre Besitzer wechselnden Waren. In diesen Waren ist nun aber nicht lediglich menschliche Arbeit geronnen, sondern zugleich auch dasjenige Metaphysische, welches zuvor in den Beziehungen währte und wirkte, die im vorgängigen Feudalismus stattfanden. „[E]s ist so, als ob Glaube, Aberglaube und metaphysische Mystifikationen der Menschen, angeblich gekrönt von der rationalen, utilitaristischen Persönlichkeit, nun in den ‚gesellschaftlichen Verhältnissen zwischen Sachen‘ verkörpert wären. Nicht mehr die Menschen glauben, sondern an ihrer Stelle die Sachen selbst. [T.D.: Hervorhebung im Original]“[18].
Žižek erinnert an die Chöre des antiken Theaters, denen er eine besondere, mediale Rolle zugesteht, und dies in zweierlei Hinsicht. Einerseits schaffen sie eine Stimmung, in die sich der Besucher, der von den Erfahrungen und Erlebnissen des alltäglichen Lebens verstimmt ist, hinein versetzen kann. Ja, sie sind vermögens, ihn förmlich in diese Stimmung hineinzuziehen. Dies nun ermöglicht eine bessere Vermittlungsweise dessen, was im Theater währt, was an Sinn und Bedeutung den Besucher erreichen soll. Andererseits sind die Chöre insofern Medium, als dass sie dem Besucher die Mühe abnehmen, sich in eine besondere Stimmung zu schicken. Die Chöre sind bereits die Stimmung, der Besucher kann sich zurück lehnen und das Geschehen beobachten[16]. Žižek erinnert, um diese Überlegung verständlich werden zu lassen, an den Warenfetischismus, wie ihn Marx dargelegt hat, unterzieht ihn aber einer (seiner) besonderen Leseart. So zeichnen sich im vorindustriellen feudalen System die Beziehungen zwischen den Menschen durch eine Verwobenheit „ideologischen Glaubens und Aberglaubens“[17] aus. Im Zuge der industriellen Revolution wurde die Freiheit des Menschen zusehends bedeutsamer. Das kapitalistische System braucht den Vertragspartner, der formal mündig und frei über sich und seine Arbeitskraft verfügen kann. Die Beziehung, die sich im Verlauf der Industrialisierung zwischen den Menschen konstituiert, geschieht mittelbar – und zwar durch die ihre Besitzer wechselnden Waren. In diesen Waren ist nun aber nicht lediglich menschliche Arbeit geronnen, sondern zugleich auch dasjenige Metaphysische, welches zuvor in den Beziehungen währte und wirkte, die im vorgängigen Feudalismus stattfanden. „[E]s ist so, als ob Glaube, Aberglaube und metaphysische Mystifikationen der Menschen, angeblich gekrönt von der rationalen, utilitaristischen Persönlichkeit, nun in den ‚gesellschaftlichen Verhältnissen zwischen Sachen‘ verkörpert wären. Nicht mehr die Menschen glauben, sondern an ihrer Stelle die Sachen selbst. [T.D.: Hervorhebung im Original]“[18].
Wir haben es hier mit einer, übrigens von Lacan vorangetriebenen Verabschiedung der klassischen Trennung von Innen und Außen zu tun, der zufolge der Glaube innerlich, das Wissen äußerlich (weil verifizierbar) ist: „Die psychoanalytische Formel für den Fetischismus […] lautet […]: Ich weiß ja, dass Waren gewöhnliche Dinge sind, ganz wie andere Dinge, aber dennoch…(in der Praxis behandle ich sie so, als wären sie metaphysische Wesen.)“[19]. Formen dieser Veräußerung sind in den unterschiedlichsten Zusammenhängen auffindbar. Im islamischen Kulturkreis sind es die Klageweiber, die für mich trauern, während ich mich der Aufteilung des Erbes widmen kann. Im Falle der tibetanischen Gebetsmühlen schreibe ich mein Anliegen auf einen Zettel, drehe die Mühle und lasse diese für mich beten, während ich mich womöglich den absonderlichsten, auch obszönsten Gedanken widme. Ähnlich verhält es sich bei jenen Fernseh-Shows, die mit Lachkonserven arbeiten. Vielleicht wird hier die Verknüpfung zu den Chören des von Žižek als Beispiel angeführten klassischen Theaters am deutlichsten. Sie sind einerseits Transporteure einer Stimmung, andererseits übernehmen die Lachsalven selbst mein Lachen. Sie wären dann die Externalisierung meiner Stimmung, die getrennt von mir existiert. Allerdings – und dies bezeichnet die Irritation, welche diese Überlegung begleitet – stellt sich hierbei die Frage nach der Verbindung zwischen mir als Zuschauer, zwischen meiner Stimmung und der Lachkonserve, die als Anderer auftritt und für mich in Stimmung kommt. Ich trage meine Stimmung nicht nach außen, vielmehr beobachte ich, wie der Andere für mich in Stimmung ist. Mit anderer Worten: Wo bleibe ich, wo bin ich, während ich all dies beobachte?
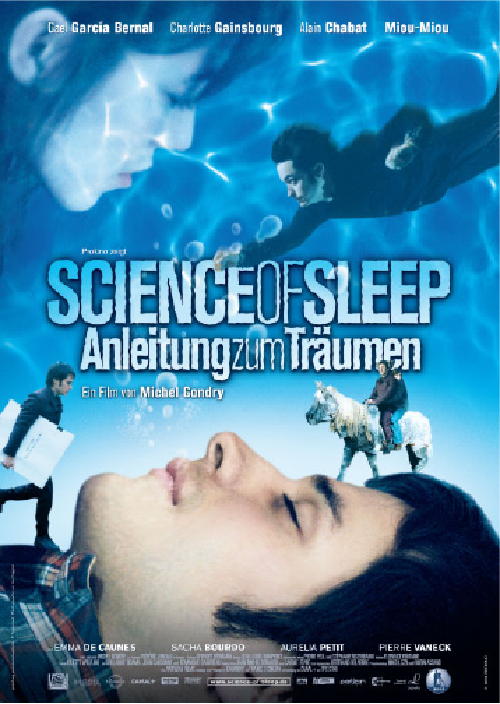 Die Distanz zwischen dem Film und zwischen mir scheint unüberwindbar. Paul Valéry formuliert dieses Gefühl der Distanz in seinen „Studien und Fragmente[n] über den Traum“ m. E. treffend, wenn er schreibt: „Wenn aber das […] Bein eingeschlafen ist, dann weckt der Druck auf den Boden nicht das Angespanntsein der Muskeln, und die Kraft wird nicht zunichte gemacht, weil die Spannung nicht angeregt wird durch das Gefühl des Kontakts. Man spürt den Boden wie auf Distanz, ohne das man auf ihn einwirken könnte – wie in einem Traum [T.D.: Hervorhebung im Original].“[20]. Als Beobachter wirke ich nicht auf das Lachen ein, nicht auf den Film, nicht auf die Chöre, nicht auf das Stück, ich wirke nicht auf das ein, was als ein mir Anderer meine Stimmung macht. Und dennoch, dies ist das Seltsame, bin ich nicht allein der Beobachter dessen, was sich vor meinen Augen abspielt, denn ähnlich wie in einem Traum begleitet mich der Eindruck, Teil des Geschehens zu sein, freilich ohne es steuern zu können.
Die Distanz zwischen dem Film und zwischen mir scheint unüberwindbar. Paul Valéry formuliert dieses Gefühl der Distanz in seinen „Studien und Fragmente[n] über den Traum“ m. E. treffend, wenn er schreibt: „Wenn aber das […] Bein eingeschlafen ist, dann weckt der Druck auf den Boden nicht das Angespanntsein der Muskeln, und die Kraft wird nicht zunichte gemacht, weil die Spannung nicht angeregt wird durch das Gefühl des Kontakts. Man spürt den Boden wie auf Distanz, ohne das man auf ihn einwirken könnte – wie in einem Traum [T.D.: Hervorhebung im Original].“[20]. Als Beobachter wirke ich nicht auf das Lachen ein, nicht auf den Film, nicht auf die Chöre, nicht auf das Stück, ich wirke nicht auf das ein, was als ein mir Anderer meine Stimmung macht. Und dennoch, dies ist das Seltsame, bin ich nicht allein der Beobachter dessen, was sich vor meinen Augen abspielt, denn ähnlich wie in einem Traum begleitet mich der Eindruck, Teil des Geschehens zu sein, freilich ohne es steuern zu können.
Das Versunken-Sein, oder: Zur Dialektik von Wahrnehmung und Vorstellung
Wir haben bisher unser Augenmerk zum einen auf das dialektische Moment der Wahrnehmung gerichtet. Hier wird ein im Film transportierter Sinn aufgenommen und im Verein mit einem eigenen Sinngenerieren hervorgebracht. Zum anderen stellten wir die Überlegungen Žižeks vor, der ein Moment der Externalisierung ehemals innerer Vorgänge beschreibt und somit den Zuschauer, nun von seiner „Stimmungsarbeit“ getrennt, in eine doppelsinnige Rolle verortet. Hier scheint er Beobachter des Geschehens zu sein, zugleich ist er aber auch in seinem Versunken-Sein in den Film von dem Gefühl beseelt, Teil des Geschehens zu sein. Wie nun diese Ambiguität, die durch ein Getrennt- und Verwobensein bezeichnet ist, zu verstehen ist, gilt ist genauer zu untersuchen. Unterstützen sollen uns hierbei die Überlegungen von Gila Friedrich, die sich in ihrer Dissertation „Identität – Ein geschichtsloses Konstrukt?“ unter anderem mit dem Verhältnis von Traum, Realität, computergenerierten Simulationen und kinematographischen Welten beschäftigt. Während wir im Rückgriff auf Gerhard Danzer eine Verschränkung von wahrnehmenden Bewusstsein und wahrgenommener Welt bestimmen konnten, arbeitet Friedrich ein dialektisches Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung heraus. Wenngleich im Zustand des Eintauchens in den Film eine Trennung von subjektiver Wahrnehmung und objektiven Vorstellungen unmöglich erscheint, ist diese Trennung theoretisch dennoch möglich und – so Friedrich – für eine Realitätsprüfung unabdingbar: „Gerade dass im Traum Vorstellung und Wahrnehmung zusammenfallen und den Träumenden in der omnipotenten Differenzlosigkeit von Innen und Außen gefangen hält, begründet den Realitätseindruck wie zugleich die Unmöglichkeit einer Realitätsprüfung.“[21].
Wir können diesem Gedanken leichter folgen, wenn wir uns einer grundsätzlichen Überlegung der Gestaltpsychologie bedienen, die von Danzer – der sich hier übrigens auf Nicolai Hartmann beruft – als intentio recta und intentio obliqua bezeichnet wird[22]. In der intentio recta werden wir den Dingen, die uns in der Welt erscheinen, in ihrer Ganzheit, ihrer Gestalt, gewahr. Wir sehen den schwermütigen, verlebten alten Arbeiter. Erst in einem zweiten Schritt richten wir in der intentio obliqua unseren Blick auf die Strukturen dessen, was wir zuvor als Ganzes vernommen haben. Nun sehen wir die gebeugte Haltung des Mannes, die gekrümmten, schwieligen Finger, die faltigen, herabhängenden Gesichtszüge, die schweren Tränensäcke usf. Hervorzuheben gilt es nun, dass weder Gestalt noch Struktur unabänderbar feststehen. Es ist nicht so, dass wir eine Gestalt vernehmen, genauer hinsehen, um die Struktur zu bestimmen, um uns anschließend unseres Ergebnisses zu erfreuen. Vielmehr wirkt die Struktur wiederum auf die Gestalt ein – und umgekehrt. Wir bemerken dies recht eindrücklich, wenn wir einer Person zum ersten Mal begegnen. Sie wirkt auf uns als Person, als Gestalt, als Ganzheit, hinterlässt einen Eindruck. Je länger wir mit ihr zu tun haben, sie erblickend ansehen, umso mehr vernehmen wir ihre Struktur (oder die Struktur unseres Eindrucks). Dieses Vernehmen wirkt nun aber wieder zurück auf den Eindruck, den sie als Ganzheit auf uns hat, oder wie Danzer es beschreibt: „Der Mensch […] bilde[t] ein Scharnier, an dem die Fragen der Welt in Antworten umgesetzt und die Verhältnisse der Welt wieder in Frage gestellt werden.“[23].
 Auf das weiter oben angesprochene Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung bezogen, bedeutet dies nun folgendes: Das, was wir wahrnehmen, provoziert in uns Vorstellungen. Diese Vorstellungen stellen nun gleichsam psychische Dispositionen dar, die wiederum auf unserer Wahrnehmung einwirken. Innerhalb dieses Verhältnisses haben wir es also im Idealfall mit einer permanenten Bestätigung unserer Vorstellung durch die Wahrnehmung zu tun: „Wäre dieser Austauschprozess (im Sinne einer außenorientierten Bild-Wahrnehmung) nicht immer zugleich auch Bestätigung innerer Bilder (im Sinne einer Vorstellungsorientierung), dann könnte von einem ‚Abtauchen‘ nicht die Rede sein, und es wäre dieses Phänomen bereits der Möglichkeit nach zu leugnen. Der Realitätsdruck entsteht demnach durch die totale Identifikation der Vorstellung mit der Wahrnehmung (oder umgekehrt).“[24].
Auf das weiter oben angesprochene Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung bezogen, bedeutet dies nun folgendes: Das, was wir wahrnehmen, provoziert in uns Vorstellungen. Diese Vorstellungen stellen nun gleichsam psychische Dispositionen dar, die wiederum auf unserer Wahrnehmung einwirken. Innerhalb dieses Verhältnisses haben wir es also im Idealfall mit einer permanenten Bestätigung unserer Vorstellung durch die Wahrnehmung zu tun: „Wäre dieser Austauschprozess (im Sinne einer außenorientierten Bild-Wahrnehmung) nicht immer zugleich auch Bestätigung innerer Bilder (im Sinne einer Vorstellungsorientierung), dann könnte von einem ‚Abtauchen‘ nicht die Rede sein, und es wäre dieses Phänomen bereits der Möglichkeit nach zu leugnen. Der Realitätsdruck entsteht demnach durch die totale Identifikation der Vorstellung mit der Wahrnehmung (oder umgekehrt).“[24].
Zur Rolle des Vor-reflexiven
Die Dialektik von Vorstellung und Wahrnehmung ermöglicht den Realitätseindruck, ermöglicht ein Versunkensein, das Eintauchen in den Film, und spätestens hier können wir nun wieder den Bogen zurück zum weiter oben angeführten anthropologischen Raum schlagen. Im Nähe-Distanz-Verhältnis in dem von Merleau-Ponty behandelten anthropologischen Raum sehe ich eine Parallele zu der von Friedrich formulierten Vorstellungs-Wahrnehmungs-Dialektik, und zwar insofern, als in beiden Fällen der Prozess in einem vor-reflexiven Stadium geschieht.
Wenn wir im Zusammenhang mit den Überlegungen zum anthropologischen Raum feststellen konnten, dass sowohl die aufkommende Nähe, als auch die entstehende Distanz nicht bewusst vom Einzelnen gesteuert wird, sondern von diesem lediglich beobachtet werden kann, dann lässt dies darauf schließen, dass Nähe und Distanz in einem Stadium geschehen, in dem die intransitive Bewegung aus dem Einzelnen heraus auf einen Widerstand (auf die Welt) trifft und eine wie auch immer geartete Resonanz erfährt. Diese Resonanz konstituiert dann das Einander-Annähern, wie auch das Voneinander-Entfernen. Erst im Zuge der reflexiven Einordnung kann dann ein Verhältnis hierzu aufgebaut werden.
Ganz ähnlich sieht es bei der Verwobenheit von subjektiver Wahrnehmung und objektiver Vorstellung aus. Das Eintauchen in den Film wird möglich, wenn die Wahrnehmung die Vorstellung beeinflusst, was wiederum auf die Wahrnehmung einwirkt. Auch hier scheint es so zu sein, dass ich als Zuschauer mein Eintauchen selbst gestalte, aber dies ist eben nur scheinbar so. Wenn weiter oben im Rückgriff auf Gila Friedrich eine Trennung von Wahrnehmung und Vorstellung allein als eine theoretische behauptet wurde, so verweist dies darauf, dass das Eintauchen und somit die Dialektik von Vorstellung und Wahrnehmung vor-reflexiv geschieht. Zugleich eröffnet dies dem Filmemacher die Möglichkeit, den Film (erneut als Raum betrachtet) so zu gestalten, dass die Anordnung von (Film-)Material und Leere dergestalt vollzogen wird, dass im entstehenden Raum zwischen Zuschauer und Film sich die Dialektik von Vorstellung und Wahrnehmung entfalten kann. Die andere Möglichkeit des Films liegt darin, ganz bewusst einen Bruch in dieser Dialektik zu erzeugen. Dies könnte in einer Ausdehnung der Lücke, in Handlungs- und Szenenwechsel geschehen, die nicht mehr nachvollziehbar sind und das Ineinanderwirken von Wahrnehmung und Vorstellung ganz gezielt auseinander reißen. Der Zuschauer würde immer wieder aus dem Film hinaus katapultiert, gleichsam zur Reflexion genötigt werden.
Weisen des Bruchs
Zum Verhältnis von Blick und Selbstkonstitution (1. Teil)
Gerade das Bewirken des Bruchs kann anhand der Verknüpfung der Überlegungen zweier Denker bezüglich des Blicks exemplifiziert werden. Jean-Paul Sartre und Slavoj Žižek befassen sich beide, wenn auch in unterschiedlicher Weise mit dem Verhältnis des Erblickens und Erblickt-werdens. Beginnen wir mit Sartre:
 Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass ich unvermögens bin, über mein Für-sich-Sein hinaus mein Sein in der Welt einzuholen. Dieses In-der-Welt-Sein erfahre ich allein durch den Anderen, genauer: Der Blick des Anderen verrät mir, dass es ein derartiges Sein von mir gibt. Allerdings kündet der Blick zugleich davon, dass über diese Erfahrung hinaus, dass es ein Sein von mir gibt, erst einmal keine Möglichkeit für mich besteht, dieses Sein einzuholen, es mir einzuverleiben, es zu meinem Eigentum zu machen, kurzum: ich kann es nicht besitzen.
Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass ich unvermögens bin, über mein Für-sich-Sein hinaus mein Sein in der Welt einzuholen. Dieses In-der-Welt-Sein erfahre ich allein durch den Anderen, genauer: Der Blick des Anderen verrät mir, dass es ein derartiges Sein von mir gibt. Allerdings kündet der Blick zugleich davon, dass über diese Erfahrung hinaus, dass es ein Sein von mir gibt, erst einmal keine Möglichkeit für mich besteht, dieses Sein einzuholen, es mir einzuverleiben, es zu meinem Eigentum zu machen, kurzum: ich kann es nicht besitzen.
Warum kann ich es nicht besitzen? Nun, wenn ich davon ausgehe, dass ich mein In-der-Welt-Sein allein im Blick des Anderen erfahren kann, so verweist dies auf zwei Dinge. Erstens bin ich in meinem In-der-Welt-Sein nichts weiter als ein Objekt, und zwar ein Objekt unter vielen. Jedoch nehme ich mich niemals so wahr, wie ich als ein Objekt in der Welt erscheine. Selbst der Blick in den Spiegel verunmöglicht mir diese Weise des Wahrnehmens, denn mein Erkennen ist hierbei ein reflexives. Anders ausgedrückt: Wenn ich mich im Spiegel erblicke, so erkenne ich mich, doch ist mir dieses Erkennen allein deshalb möglich, weil ich bereits eine Vorstellung von mir habe. Ich schaue aus mir heraus, und als dieser Schauende schaue ich mich, der ich schauend schaue, an. Das heißt: Ich erblicke auf diese Weise niemals ein Objekt, von dem ich behaupten kann, dieses Objekt bin ich, denn dies würde ein Abstrahieren von meinem Aus-mir-heraus-Schauen bedeuten, gleichsam eine Seinvergessenheit im Sinne eines Vergessens meines Für-sich-Seins. Erblicken würde ich dann aber nicht mich, sondern ein Objekt, ein Ding in der Welt. Was ich vielmehr begehre, ist „die Alterität des andern […] als meine eigne Möglichkeit zu assimilieren“[25]. Dies ist das erste; das zweite hingegen hängt mit dem Moment der Freiheit zusammen, welches dem Anderen eigen ist. Sartre spricht hier von dem Wunsch, „sich mit der Freiheit des Andern als der Begründerin seines An-sich-Seins [zu] identifizieren“[26]. Das, was der Andere an sich ist, die Weise, wie er sich als ein In-der-Welt-Seiender entwirft, verweist auf eine ihm eigene grundlegende Freiheit. Er ist frei, sich selbst zu wählen, er ist frei, sich als Möglichkeit über sein Für-sich-Sein hinaus zu entwerfen. Er transzendiert sich selbst, und die Weise, wie er dieses Transzendieren vollzieht, liegt bei ihm (, gleichsam liegt hierbei auch seine Verantwortlichkeit). Ich verfüge nicht über diese grundlegende Freiheit des Anderen, doch ist mit dieser Freiheit etwas unweigerlich verknüpft – mein In-der-Welt-Sein, genauer: die Erfahrung meines In-der-Welt-Seins. Wenn ich mich allein im respektive durch den Blick des Anderen zu erfahren vermag, wenn aber das An-sich-Sein des Anderen zugleich auf dessen fundamentale Freiheit zur Transzendenz verweist, dann ist der Blick des Anderen nichts weniger als die Konsequenz dieser Freiheit, dann ist mein Erblickt-werden und die damit verbundene Möglichkeit des Erfahrens meines In-der-Welt-Seins das Resultat der Transzendenz des Anderen. Weder die Freiheit, noch die Transzendenz als Folge dieser Freiheit kann ich „assimilieren“, noch kann ich mich damit „identifizieren“, gleichwohl währt aber mein Verlangen danach, und keine Argumente, ja selbst die Zeilen, die ich in diesem Moment schreibe, haben zur Folge, dass dieses Verlangen versiegt.
 Mit der Unmöglichkeit des Vereigentümlichen dieser Alterität ist eine Gefahr verbunden, die in der Freiheit des Anderen gründet, denn „gerade weil ich durch die Freiheit des Anderen existiere, habe ich keinerlei Sicherheit“[27]. Denn wenn mein Sein vom Blick des Anderen abhängt, dann ist der sich mir verweigernde Blick, dann ist der Entwurf des Anderen als ein Mich-nicht-Erblickender gleichbedeutend mit der Nichtexistens meines In-der-Welt-Seins. Deutlich wird dies im Theaterstück „Geschlossene Gesellschaft“. Hier reflektiert Sartre die Bedeutung des Blickes des Anderen für den Selbstentwurf und der Selbstkonstitution der Weise des Existierens. Estelle, Ines und Garcin finden sich nach ihrem Tode in der Hölle wieder. Die Hölle ist ein abgeschlossenes Zimmer, in dem es keinen Spiegel gibt. Estelle versucht alles erdenkliche, um die Zuneigung von Garcin für sich zu gewinnen. Dieser jedoch wendet sich Ines zu, die wiederum als Lesbierin der sich ihr verweigernden Estelle Avancen macht. Estelle, die sich zu schminken versucht, jedoch über keinen Spiegel verfügt, nimmt die Hilfe von Ines an, die ihr als Spiegel dienen will. Unfähig sich selbst zu sehen, ist sie vollends auf den Blick Ines‘ angewiesen: „ESTELLE: Und es ist wirklich gut? Es macht mich ganz nervös, daß ich es nicht selbst beurteilen kann […] INES: Du bist schön. ESTELLE: Ja, haben Sie denn auch Geschmack? Haben Sie meinen Geschmack? Ach, das macht einen verrückt, […] INES: Wie wär‘ das, wenn der Spiegel sich aufs Lügen verlegte? Oder wenn ich die Augen schlösse, wenn ich mich weigerte, dich anzuschauen. Was fingest du mit all der Schönheit an?“[28]. Das Ende der Gefahr würde folglich allein in einer besonderen Weise der Aneignung des Anderen liegen, und diese Weise besteht in der Aneignung des Anderen in seiner Freiheit, oder – wenn man dies so formulieren will – in der Unterwerfung der Freiheit des Anderen unter die eigene Freiheit.
Mit der Unmöglichkeit des Vereigentümlichen dieser Alterität ist eine Gefahr verbunden, die in der Freiheit des Anderen gründet, denn „gerade weil ich durch die Freiheit des Anderen existiere, habe ich keinerlei Sicherheit“[27]. Denn wenn mein Sein vom Blick des Anderen abhängt, dann ist der sich mir verweigernde Blick, dann ist der Entwurf des Anderen als ein Mich-nicht-Erblickender gleichbedeutend mit der Nichtexistens meines In-der-Welt-Seins. Deutlich wird dies im Theaterstück „Geschlossene Gesellschaft“. Hier reflektiert Sartre die Bedeutung des Blickes des Anderen für den Selbstentwurf und der Selbstkonstitution der Weise des Existierens. Estelle, Ines und Garcin finden sich nach ihrem Tode in der Hölle wieder. Die Hölle ist ein abgeschlossenes Zimmer, in dem es keinen Spiegel gibt. Estelle versucht alles erdenkliche, um die Zuneigung von Garcin für sich zu gewinnen. Dieser jedoch wendet sich Ines zu, die wiederum als Lesbierin der sich ihr verweigernden Estelle Avancen macht. Estelle, die sich zu schminken versucht, jedoch über keinen Spiegel verfügt, nimmt die Hilfe von Ines an, die ihr als Spiegel dienen will. Unfähig sich selbst zu sehen, ist sie vollends auf den Blick Ines‘ angewiesen: „ESTELLE: Und es ist wirklich gut? Es macht mich ganz nervös, daß ich es nicht selbst beurteilen kann […] INES: Du bist schön. ESTELLE: Ja, haben Sie denn auch Geschmack? Haben Sie meinen Geschmack? Ach, das macht einen verrückt, […] INES: Wie wär‘ das, wenn der Spiegel sich aufs Lügen verlegte? Oder wenn ich die Augen schlösse, wenn ich mich weigerte, dich anzuschauen. Was fingest du mit all der Schönheit an?“[28]. Das Ende der Gefahr würde folglich allein in einer besonderen Weise der Aneignung des Anderen liegen, und diese Weise besteht in der Aneignung des Anderen in seiner Freiheit, oder – wenn man dies so formulieren will – in der Unterwerfung der Freiheit des Anderen unter die eigene Freiheit.
Warum aber ist die „Assimilation“ der Freiheit des Anderen so bedeutsam? Mein Sein in der Welt hängt daran, ja, aber darüber hinaus bedeutet das Eigentümlich-Machen der Alterität das Begründen des eigenen Entwurfs. Dieser Gedanke muss erklärt werden. Wenn ich mich beispielsweise als ein Mensch entwerfe, der gegenüber einer Frau, die er begehrt, als charmant auftritt, dann geschieht dieser Entwurf freilich als ein in die Welt geworfener, den zu verwirklichen ich mich anstrenge. Aber von wo aus geschieht dieser Wurf? Als Ent-wurf ent-kommt er meinem Für-sich-Sein, ich entwerfe mich, werfe etwas aus mir heraus in die Welt, ent-werfe mich in eine Welt, in der ich mich mir selbst nicht zugänglich bin, ent-werfe mich also in eine Unzugänglichkeit (aufgrund dieser ich ja gerade die Freiheit des Anderen begehre). Von wo aus aber ent-werfe ich mich? Von meinem Für-sich-Sein? Ja! Doch ist mein Für-sich-Sein m. E. keine eigene Welt, ähnlich des Noumenon, das des Phänomenon jenseitig, gleichsam in einer hiervon abgetrennten Welt existiert. Vielmehr erscheint mir das Für-sich-Sein eng mit dem An-sich-Sein (oder dem In-der-Welt-Sein) verwoben. Jeder Entwurf aus dem Für-sich-Sein in die Welt hinaus würde zu einem unmöglichen werden, wäre nicht wenigstens eine Ahnung vom eigenen So-Sein als Basis für jeden Entwurf aus dem Für-sich-Sein heraus vorhanden.[29] Für diese Ahnung (die niemals eine Gewissheit ist) bedarf es der Erfahrung des Erblickt-Werdens; für den Entwurf im Sinne einer Möglichkeit, die wirklich werden kann, braucht es eben diese Ahnung, braucht es eines solchen Blicks.
Sartre spricht in seinen Überlegungen zum Blick von einer Scham, die sich darin zeigt, dass ich für denjenigen, der mich erblickt, schlicht und ergreifend ein Ding unter Dingen, kurzum: ein Objekt bin und ich mir eben dieser Objekthaftigkeit, die ich für den Anderen bin, eben dann, wenn ich seinen Blick erblicke, bewusst bin: „Die reine Scham ist nicht das Gefühl, dieses oder jenes tadelswerte Objekt zu sein, sondern überhaupt ein Objekt zu sein, das heißt, mich in diesem verminderten, abhängigen und erstarrten Objekt, das ich für den Anderen bin, wiederzuerkennen. Die Scham ist Gefühl eines Sündenfalls, nicht weil ich diesen oder jenen Fehler begangen hätte, sondern einfach deshalb, weil ich in die Welt ‚gefallen‘ bin, mitten in die Dinge, und weil ich die Vermittlung des Anderen brauche, um das zu sein, was ich bin.“[30].
Zum Verhältnis von Blick und Selbstkonstitution (2. Teil)
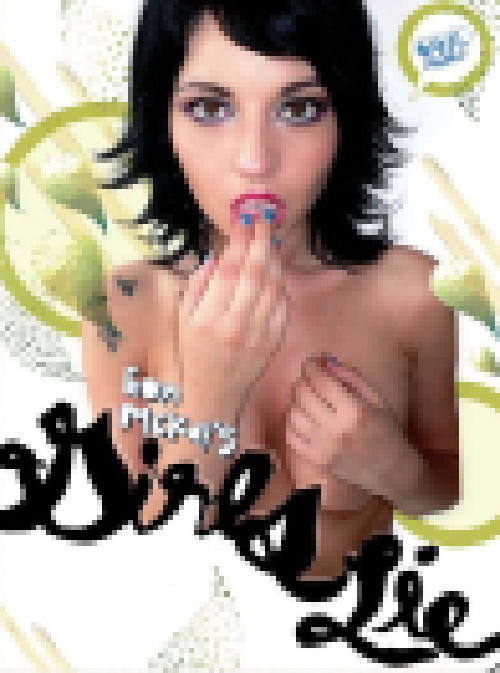 Slavoj Žižek sieht im pornografischen Film den Blick als Schlüsselfigur. Die Schamlosigkeit besteht im Blick der Frau, die, während des Sexualakts in die Kamera blickt. Der Zuschauer empfängt diesen Blick, sieht sich erblickt, und „es ist dieser Blick, der die Szene obszön und schamlos macht.“[31]. Der Zuschauer hingegen fühlt sich beschämt, und diese Scham wird gesteigert durch einen Bruch zwischen Auge und Blick. Dieser Bruch wird, so Žižek, durch die sich drehende und ihr Geschlecht der Kamera präsentierenden Schauspielerin offenbar. Der Blick des Zuschauers richtet sich auf die klaffende Öffnung der Vagina und nicht auf die Augen der Frau. „Der Blick ist somit nicht da, wo man ihn erwarten würde […], sondern in dem traumatischen Objekt/Loch, welches unser Sehen fixiert und uns intensiv betrifft – die Augen [der Schauspielerin, die] uns anstarrt, erinnern uns eher an: ‚Siehst Du, ich sehe dich meinen Blick beobachten…’“[32].
Slavoj Žižek sieht im pornografischen Film den Blick als Schlüsselfigur. Die Schamlosigkeit besteht im Blick der Frau, die, während des Sexualakts in die Kamera blickt. Der Zuschauer empfängt diesen Blick, sieht sich erblickt, und „es ist dieser Blick, der die Szene obszön und schamlos macht.“[31]. Der Zuschauer hingegen fühlt sich beschämt, und diese Scham wird gesteigert durch einen Bruch zwischen Auge und Blick. Dieser Bruch wird, so Žižek, durch die sich drehende und ihr Geschlecht der Kamera präsentierenden Schauspielerin offenbar. Der Blick des Zuschauers richtet sich auf die klaffende Öffnung der Vagina und nicht auf die Augen der Frau. „Der Blick ist somit nicht da, wo man ihn erwarten würde […], sondern in dem traumatischen Objekt/Loch, welches unser Sehen fixiert und uns intensiv betrifft – die Augen [der Schauspielerin, die] uns anstarrt, erinnern uns eher an: ‚Siehst Du, ich sehe dich meinen Blick beobachten…’“[32].
Nun mag die Vorstellung, von einer Schauspielerin durch den Bildschirm hindurch erblickt zu werden, unsinnig erscheinen, so doch gänzlich klar sein dürfte, dass ich von ihr nicht erblickt werden kann. Ich bin für sie kein Objekt und kann daher in ihrem Blick auch nicht meine Objekthaftigkeit, die ich für sie habe, erblicken. Dies ist nun aber auch gar nicht notwendig, wie uns Sartre ausdrücklich darlegt: „Jeder auf mich gerichtete Blick manifestiert sich in Verbindung mit dem Erscheinen einer sinnlichen Gestalt in unserem Wahrnehmungsfeld, aber im Gegensatz zu dem, was man glauben könnte, ist er an keine bestimmte Gestalt gebunden.“[33]. Es ist nicht erforderlich, dass ich eine reale Person sehe. Wenn Gerhart Polt in seinen Stücken „Fast wia im richtigen Leben“ mich aus dem Bildschirm heraus ansieht, er mit mir spricht, kann ich mich ohne weiteres erblickt fühlen. Ja, selbst die blinde Frau, die vor mir steht und ihre Augen in meine Richtung lenkt, kann ich als eine mich erblickende Frau wahrnehmen.
Dies nun scheint mir eng mit der oben angeführten Dialektik von Wahrnehmung und Vorstellung verknüpft zu sein. Die mich aus dem Film heraus anblickende Person nehme ich als eine mich erblickende wahr, meine Erwartung wird darum dergestalt sein, dass sie durch das mir Präsentierte bedient wird. Ich mache mich – wenngleich in einem vor-reflexiven Stadium, zu einem Erblickt-Werdenden, ja, ich kann gar nicht anders. Allein in der Theoretisierung bin ich der Lage eine Trennung zwischen Vorstellung und Wahrnehmung zu erlangen. Hier kann ich aussprechen, mich als ein Sich-Schämender, als ein Erblickter, als an ein Angesprochener usf. zu sehen, hier kann ich mich dazu verhalten. Der Film selber oszilliert zwischen diesen beiden Ermöglichungen. Die Filmkomposition vermag einerseits das Eintauchen und die damit verbundene Stärkung des Vor-reflexiven zu erleichtern. Anderseits ermöglicht die Gestaltung des Films einen für die Reflexivität notwendigen Bruch. Dies kann, um nur ein Beispiel zu nennen, durch Brüche in der Anordnung von Inhalt und Lücke im Film geschehen. Die innerfilmische oder, wenn man so will, vertikale Gestaltung wirkt anschließend auf das Verhältnis von Zuschauer und Film (auf die Vorstellungs-Wahrnehmungs-Beziehung), also horizontale Ebene ein.
Zusammenfassendes Schlusswort
Ausgangspunkt des vorliegenden Textes war die im Abschnitt Weisen der Erfahrung an Merleau-Ponty angeknüpfte Überlegung zur Art und Weise, wie ein Ding bzw. ein Anderer mir erscheint. Hierbei wurde deutlich, dass der Modus der Wahrnehmung eng an das Verhältnis von Nähe und Distanz zum Ding respektive zum Anderen geknüpft ist. Nähe und Distanz geschieht hierbei aus mir heraus, allerdings schaffe ich weder die Nähe, noch die Distanz in dem Sinne, dass ich als das Zugrundeliegende auftrete. So wurde im Zusammenhang mit der Mehrdimensionalität, die laut Sesink im Bildungsbegriff währt, eine Übertragung der drei Dimensionen (transitiv, intransitiv und reflexiv) auf das Verhältnis zum Anderen vorgenommen, wobei bemerkt wurde, dass das, was aus mir heraus geschieht, allein reflexiv eingeholt werden kann, wodurch ein Verhältnis zu diesem Geschehen möglich wird.
In Weisen der Gestaltung wurde das für den Raum Konstitutive thematisiert. Sowohl die Begrenzung, welche ein Innen und ein Außen ermöglicht, als auch die Leere zwischen den Dingen, sowie die Anordnung der Gegenstände erwiesen sich hierbei als bedeutsam. Letzteres wurde im Rückgriff auf Merleau-Ponty, wie auch auf Arnheim als (auch für den Film) künstlerisches Moment herausgestellt. So vermag eben durch die Anordnung von (Film-)Material Sinn und Bedeutung generiert und transportiert werden.
In Anlehnung an Danzer zeigte sich, dass Sinn und Bedeutung eines Films der Zuschauer in einem dialektischen Verhältnis von wahrnehmenden Bewusstsein und wahrgenommener Welt erfährt. Die Verabschiedung der Lacan’schen Trennung von Innen (Glauben) und Außen (Wissen), wird, dies wurde kontrastierend als alternative Überlegung angeführt, dadurch offenbar, dass wir den Dingen Metaphysisches beimessen. Lachkonserven übernehmen unsere Stimmung, wir selbst bleiben dabei hinter den Dingen zurück und entbehren gleichsam jeglicher Kontrolle über die Dinge.
Das Eintauchen in einen Film wird möglich durch die dialektische Verwobenheit von Wahrnehmung und Vorstellung. Die Wahrnehmung provoziert Vorstellungen, die wiederum psychische Dispositionen für die Wahrnehmung darstellen. Sowohl im dialektischen Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung (Friedrich), als auch im dialektischen Moment der Wahrnehmung (Danzer) spielt die Reflexion keine Rolle. Das Vor-Reflexive ist dabei für die Anordnung des Filmmaterials von großer Bedeutung. So kann diese Anordnung eine eingängige Perzeption und folglich ein Eintauchen in den Film ermöglichen respektive fördern, sie kann aber ebenso gezielt Brüche erzeugen und den Zuschauer somit zur Reflexion nötigen.
Auf diese Überlegungen implizit zurückgreifend wurde im darauf folgenden Teil Weisen des Bruchs Voraussetzung und Möglichkeit des besagten Bruchs durch den Film in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt. Mit Hilfe von Sartre zeigte sich, wie der Mensch dadurch, dass er sich vom Anderen erblickt fühlt (ganz gleich, ob er wirklich erblickt wird) Scham empfindet. So ist er im Blick des Anderen allein ein Ding unter Dingen. Sein Für-sich-Sein bleibt dabei dem Anderen unweigerlich verborgen.
Mit Žižek wurde dieser Gedanke auf den pornografischen Film angewandt, wobei sich die Verwobenheit von Wahrnehmung und Vorstellung wesentlich für das hierbei währende Schamgefühl erweist. Zuletzt fanden zwei Bewegungen Erwähnung. Die vertikale oder innerfilmische ist bezeichnet durch die Anordnung des Filmmaterials und die technische Gestaltung des Filmes (Schnitte, Szenenwechsel usf.). Für die horizontale Bewegung konstitutiv ist das Verhältnis von Zuschauer und Film und damit eben gerade die Dialektik von Wahrnehmung und Vorstellung. Beide Bewegungen wirken dabei aufeinander ein, demnach die Gestaltung des Films (als Raum betrachtet) das Verhältnis von Zuschauer und Film dahingehend beeinflusst, dass Reflexivität gefördert oder Eintauchen ermöglicht werden kann. Dies herauszuarbeiten soll der Betrag der vorliegenden Arbeit sein.
Anmerkungen & Bibliografie
- Merleau-Ponty, Maurice: Das Kino und die neue Psychologie (1947). In: Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2003, S.32
- ebd., S.33
- ebd., S.34
- ebd., S.37
- Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter, 1966, S.332
- Sesink, Werner: Einführung in die Pädagogik. Münster: LIT Verlag, 2001, S.182
- Heydorn, Heinz-Joachim: Über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1970, S.9
- Im Willen (nach Verschmelzung) währt hierbei zugleich eine interessante Dialektik. Der Wille will sich, und weil er sich will, will er niemals, dass sich dem Wille das, was er jenseits des bloßen Wille-Seins will, erfüllt. Das heißt: Die Verschmelzung wäre sein Ende, denn die Verschmelzung würde einhergehen mit dem Selbstverlust, und im Selbstverlust endet der Wille. Der Wille, der sich aber will, will eben nicht die Verschmelzung, sondern will sich als einer, der die Verschmelzung will.
- vgl. Sesink, Werner: Die Zukunft des Bildungsraums (unveröffentlichtes Manuskript), 2008, S.4
- ebd., S.5
- Merleau-Ponty, Maurice: Das Kino und die neue Psychologie (1947). In: Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2003, S.44
- Arnheim, Rudolf: Film als Kunst. Berlin: Suhrkamp, 2002, S.26
- Arnheim, Rudolf: Kunst heute und der Film (1965). In: Arnheim, Rudolf: Kritiken und Aufsätze zum Film. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1977., S.57
- Merleau-Ponty, Maurice: Das Kino und die neue Psychologie (1947). In: Merleau-Ponty: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2003, S.44
- Danzer, Gerhard: Merleau-Ponty. Ein Philosoph auf der Suche nach Sinn. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2003, 141
- vgl. Žižek, Slavoj: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und die Medien. Berlin: Merve Verlag, 1991, S.49ff.
- ebd., S.51
- ebd.
- ebd., S.51f.
- Valéry, Paul: Zur Philosophie und Wissenschaft. In: Schmidt-Radefeldt, Jürgen: Paul Valéry Werke. Frankfurter Ausgabe in 7 Bänden (Bd. 4). Frankfurt a. M.: Insel Verlag, 1989, S.215
- Friedrich, Gila: Identität – ein geschichtsloses Konstrukt? Pädagogische Überlegungen zum Identitätsbegriff einer technisierten und zunehmend digitalisierten Kultur. Berlin: Lit. (Zugl.: Darmstadt, Univ., Diss., 2008) 2008, S.151
- vgl. Danzer, Gerhard: Merleau-Ponty. Ein Philosoph auf der Suche nach Sinn. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2003, 136
- ebd., 137
- Friedrich, Gila: Identität – ein geschichtsloses Konstrukt? Pädagogische Überlegungen zum Identitätsbegriff einer technisierten und zunehmend digitalisierten Kultur. Berlin: Lit. (Zugl.: Darmstadt, Univ., Diss., 2008) 2008, S.152f.
- Sartre, Jean Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007, S.639
- ebd., S.640
- ebd., S.641
- Sartre, Jean Paul: Geschlossene Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006, S.80f.
- Die Dramatik, die offenbar wird, wenn das Für-sich-Sein seine Verbindung zur Welt/zum Anderen zu verlieren meint, kann zu einem fundamentalen Zweifel hinsichtlich der eigenen Existenz anwachsen. Sartre verdeutlich diese existenzielle Angst, wenn er in seinem Stück Der Teufel und der Liebe Gott Götz in einem verzweifelten Moment zu Hilda sagen lässt: „Sieh mich an, höre keinen Augenblick auf, mich anzusehen: Die Welt ist erblindet; wenn Du den Kopf abwenden würdest, hätte ich Angst, zu nichts zur werden.“ (Sartre, Jean Paul: Der Teufel und der liebe Gott. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005, S. 160).
- Sartre, Jean Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007, S.516
- Žižek, Slavoj: Die Pest der Phantasmen. Die Effizienz des Phantasmatischen in den neuen Medien. Wien: Passagen Verlag GmbH, 1997, S.169
- ebd., 170
- Sartre, Jean Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007, S.465




