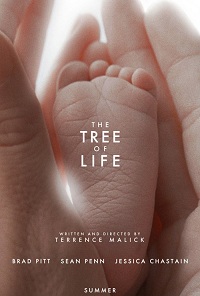 Nun ist er also da. „The Tree of Life“ – ein Film, auf dem ungeheure Erwartungen lasten, weil er seit Jahren in Produktion war, sein Start immer wieder verschoben wurde und im Oeuvre des Regie-Unikats Terrence Malick erst das fünfte Werk innerhalb von 40 Jahren darstellt. Malick gilt – wie Kubrick – als Perfektionist. Und je mehr durchsickerte, dass „The Tree of Life“ ein ähnlich avantgardistischer und philosophisch anspruchsvoller Film werden würde wie Kubricks „2001: A Space Odyssey“, wurden aus Cineasten Jünger, die weniger einen Film als eine Offenbarung antizipierten. Fast schon erwartungsgemäß wurde „The Tree of Life“ vor wenigen Wochen zum Sieger des prestigeträchtigen Festivals von Cannes gekürt. Und nun ist er also da, im Kino, aus ätherischen Höhen in die Profanität des für alle Sichtbaren hinabgestiegen, wo es mit Romantic Comedies und Action-Blockbustern zu konkurrieren gilt. Im Legendendunst seiner Vorgeschichte mag es enttäuschend erscheinen, dass „The Tree of Life“ letztlich nicht das große Meisterwerk vom Range der Kubrick’schen Vision ist. Nimmt man aber Abstand von diesen übersteigerten, nahezu unerfüllbaren Erwartungen, bleibt dennoch ein sehr gelungener, visuell berauschender und atmosphärisch starker Film.
Nun ist er also da. „The Tree of Life“ – ein Film, auf dem ungeheure Erwartungen lasten, weil er seit Jahren in Produktion war, sein Start immer wieder verschoben wurde und im Oeuvre des Regie-Unikats Terrence Malick erst das fünfte Werk innerhalb von 40 Jahren darstellt. Malick gilt – wie Kubrick – als Perfektionist. Und je mehr durchsickerte, dass „The Tree of Life“ ein ähnlich avantgardistischer und philosophisch anspruchsvoller Film werden würde wie Kubricks „2001: A Space Odyssey“, wurden aus Cineasten Jünger, die weniger einen Film als eine Offenbarung antizipierten. Fast schon erwartungsgemäß wurde „The Tree of Life“ vor wenigen Wochen zum Sieger des prestigeträchtigen Festivals von Cannes gekürt. Und nun ist er also da, im Kino, aus ätherischen Höhen in die Profanität des für alle Sichtbaren hinabgestiegen, wo es mit Romantic Comedies und Action-Blockbustern zu konkurrieren gilt. Im Legendendunst seiner Vorgeschichte mag es enttäuschend erscheinen, dass „The Tree of Life“ letztlich nicht das große Meisterwerk vom Range der Kubrick’schen Vision ist. Nimmt man aber Abstand von diesen übersteigerten, nahezu unerfüllbaren Erwartungen, bleibt dennoch ein sehr gelungener, visuell berauschender und atmosphärisch starker Film.
 Schon die ersten Sekunden machen deutlich, dass Malick nichts anderes vorhat, als in die höchsten Dimensionen der Filmgeschichte vorzustoßen. „Wo warst du, als ich die Erde erschuf?“, fragt ein Bibelzitat aus dem Buch Hiob, ehe sich in der Leinwand ein Loch aus Licht öffnet, der Geburtskanal der Menschheit, die ins präexistente Sein geworfen wird. Später wird der Film in der Zeit zurück schreiten, an den Anfang des Universums, und die Kosmogonie/Genesis zeigen. Minutenlang ergießen sich Bilder über die Leinwand, die sonst nur im Experimentalfilm zu sehen sind. Malick lässt sein ohnehin geringes Interesse am Plot gänzlich fahren und gibt sich rein abstrakten Sequenzen hin, in der das Universum geboren wird. Das sieht aus wie eine Mischung aus den immersiven Drogentrips aus „Enter the Void“, den neonfarbenen Weltraumfahrten aus „2001: A Space Odyssey“ und den Testaufnahmen für Clouzots nie fertig gestellten „L’Enfer“, die von der Doku „L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot“ veröffentlicht wurden. Nebelschwaden wabern über die Leinwand, farbige Flüssigkeiten fließen ineinander, angenehm reduziert ergänzen CGI-Effekte die betörenden Abstraktionen. Hier entsteht ein ganzer Bilderfundus für zukünftige Science-Fiction-Filme, der im Zusammenspiel mit der imposanten (durchaus manipulativ eingesetzten) klassischen Musik ein Gefühl der Erhabenheit evoziert. Zwischen diese von Douglas Turnbull (der bereits für Kubrick an dessen Weltraumszenen arbeitete) konzipierten Effektsequenzen schieben sich reale Aufnahmen von Urgewalten der Natur: Magmaströme explodieren, Geysire schleudern Wasser und Dampf in surreal karge Landschaften, gewaltige Wellen schieben sich über die Unterwasserkamera. Überhaupt ziehen sich Wasser und Bäume als Symbole des Lebens durch den gesamten Film.
Schon die ersten Sekunden machen deutlich, dass Malick nichts anderes vorhat, als in die höchsten Dimensionen der Filmgeschichte vorzustoßen. „Wo warst du, als ich die Erde erschuf?“, fragt ein Bibelzitat aus dem Buch Hiob, ehe sich in der Leinwand ein Loch aus Licht öffnet, der Geburtskanal der Menschheit, die ins präexistente Sein geworfen wird. Später wird der Film in der Zeit zurück schreiten, an den Anfang des Universums, und die Kosmogonie/Genesis zeigen. Minutenlang ergießen sich Bilder über die Leinwand, die sonst nur im Experimentalfilm zu sehen sind. Malick lässt sein ohnehin geringes Interesse am Plot gänzlich fahren und gibt sich rein abstrakten Sequenzen hin, in der das Universum geboren wird. Das sieht aus wie eine Mischung aus den immersiven Drogentrips aus „Enter the Void“, den neonfarbenen Weltraumfahrten aus „2001: A Space Odyssey“ und den Testaufnahmen für Clouzots nie fertig gestellten „L’Enfer“, die von der Doku „L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot“ veröffentlicht wurden. Nebelschwaden wabern über die Leinwand, farbige Flüssigkeiten fließen ineinander, angenehm reduziert ergänzen CGI-Effekte die betörenden Abstraktionen. Hier entsteht ein ganzer Bilderfundus für zukünftige Science-Fiction-Filme, der im Zusammenspiel mit der imposanten (durchaus manipulativ eingesetzten) klassischen Musik ein Gefühl der Erhabenheit evoziert. Zwischen diese von Douglas Turnbull (der bereits für Kubrick an dessen Weltraumszenen arbeitete) konzipierten Effektsequenzen schieben sich reale Aufnahmen von Urgewalten der Natur: Magmaströme explodieren, Geysire schleudern Wasser und Dampf in surreal karge Landschaften, gewaltige Wellen schieben sich über die Unterwasserkamera. Überhaupt ziehen sich Wasser und Bäume als Symbole des Lebens durch den gesamten Film.
 Ja, einen Plot gibt es auch. Eine Durchschnittsfamilie lebt in den 50er-Jahren im texanischen Waco, der Vater (Brad Pitt) ist liebevoll, aber autoritär, die Mutter (Jessica Chastain) überrein, übersanft, überirdisch schön. Der schnöselige Architekt Jack (Sean Penn) erinnert sich in der Gegenwart an diese, seine Vergangenheit, den traumatischen Tod eines Bruders, die furchteinflößende Präsenz des Vaters sowie die eigene von Aggressionen, Rebellion und Vater-Sohn-Konflikten erfüllte Kindheit. Allerdings „vergisst“ der Film diese Geschichte während seiner kosmischen Fahrten gänzlich, fragmentiert viele Familienszenen durch rasche Schnitte und übertönt Dialoge mit opulenter Sakralmusik. Die Erzählung wird samt ihrer Figuren zum reinen MacGuffin für Malicks philosophische Kontemplationen. Die wohl größte Schwäche des Films ist daher gerade die äußerst dünne Verbindung zwischen den abstrakten und den narrativen Szenen, den kosmologischen Meditationen und der konkreten Familiengeschichte. „The Tree of Life“ hat wenig zu sagen und zu erzählen, stattdessen konzentriert sich Malick auf das sinnliche, fühlbare Zeigen, auf die visuelle Reizüberflutung, die nicht der Narration dient, sondern ein Selbstzweck ist.
Ja, einen Plot gibt es auch. Eine Durchschnittsfamilie lebt in den 50er-Jahren im texanischen Waco, der Vater (Brad Pitt) ist liebevoll, aber autoritär, die Mutter (Jessica Chastain) überrein, übersanft, überirdisch schön. Der schnöselige Architekt Jack (Sean Penn) erinnert sich in der Gegenwart an diese, seine Vergangenheit, den traumatischen Tod eines Bruders, die furchteinflößende Präsenz des Vaters sowie die eigene von Aggressionen, Rebellion und Vater-Sohn-Konflikten erfüllte Kindheit. Allerdings „vergisst“ der Film diese Geschichte während seiner kosmischen Fahrten gänzlich, fragmentiert viele Familienszenen durch rasche Schnitte und übertönt Dialoge mit opulenter Sakralmusik. Die Erzählung wird samt ihrer Figuren zum reinen MacGuffin für Malicks philosophische Kontemplationen. Die wohl größte Schwäche des Films ist daher gerade die äußerst dünne Verbindung zwischen den abstrakten und den narrativen Szenen, den kosmologischen Meditationen und der konkreten Familiengeschichte. „The Tree of Life“ hat wenig zu sagen und zu erzählen, stattdessen konzentriert sich Malick auf das sinnliche, fühlbare Zeigen, auf die visuelle Reizüberflutung, die nicht der Narration dient, sondern ein Selbstzweck ist.
 Entsprechend sensorisch, unobjektiv und vor allem aktiv verhält sich Emmanuel Lubezkis Kamera: Sie wird in die Bewegungen der Figuren hineingesogen, empfindet sie nach, gleitet nebenher, fährt in Close-ups auf die Körper zu und in das Bild hinein. Unkonventionelle Blickwinkel – zahlreiche Untersichten, vereinzelte Überkopf-Einstellungen – verzerren die Proportionen und erzeugen damit Verwirrung, Verfremdung, Distanz. Der Effekt steht hier deutlich im Vordergrund gegenüber der bloßen Abbildung von Handlungen. Komplementär dazu unterbindet die hohe Schnittfrequenz die Entwicklung von Szenen und damit – bescheidenerweise – auch den Genuss der oft großartigen visuellen Kompositionen. Einmal sehen wir aus der Ferne Vogelschwärme, die in geschlossenen Formationen erstaunlich elegante, spontan wechselnde Anordnungen bilden – ein andermal zeigt eine surreale Sequenz ein im Fluss versunkenes Haus, aus dem die Bewohner buchstäblich auftauchen. Malicks berauschende Naturbilder vertreten einen Pantheismus, der in vielen fein beobachteten Details die unfassbare, überbordende Schönheit des Seins bestaunt. Ob animierte Saurier und fliegende Frauen in diesem Zusammenhang der ehrfürchtigen Betrachtung göttlicher/natürlicher Schöpfungen eher abträglich, weil unfreiwillig komisch sind, muss jeder Zuschauer selbst entscheiden.
Entsprechend sensorisch, unobjektiv und vor allem aktiv verhält sich Emmanuel Lubezkis Kamera: Sie wird in die Bewegungen der Figuren hineingesogen, empfindet sie nach, gleitet nebenher, fährt in Close-ups auf die Körper zu und in das Bild hinein. Unkonventionelle Blickwinkel – zahlreiche Untersichten, vereinzelte Überkopf-Einstellungen – verzerren die Proportionen und erzeugen damit Verwirrung, Verfremdung, Distanz. Der Effekt steht hier deutlich im Vordergrund gegenüber der bloßen Abbildung von Handlungen. Komplementär dazu unterbindet die hohe Schnittfrequenz die Entwicklung von Szenen und damit – bescheidenerweise – auch den Genuss der oft großartigen visuellen Kompositionen. Einmal sehen wir aus der Ferne Vogelschwärme, die in geschlossenen Formationen erstaunlich elegante, spontan wechselnde Anordnungen bilden – ein andermal zeigt eine surreale Sequenz ein im Fluss versunkenes Haus, aus dem die Bewohner buchstäblich auftauchen. Malicks berauschende Naturbilder vertreten einen Pantheismus, der in vielen fein beobachteten Details die unfassbare, überbordende Schönheit des Seins bestaunt. Ob animierte Saurier und fliegende Frauen in diesem Zusammenhang der ehrfürchtigen Betrachtung göttlicher/natürlicher Schöpfungen eher abträglich, weil unfreiwillig komisch sind, muss jeder Zuschauer selbst entscheiden.
 „The Tree of Life“ ist ein tief spirituelles Werk, das sowohl eine naturwissenschaftliche als auch eine religiöse Bewunderung der Welt zulässt. Zwischen „Natur und Gnade“ müsse man sich im Leben entscheiden, heißt es früh im Film. Dann setzen Choräle ein und das Schicksal schlägt zu – das Schicksal, von dem auch eine Predigt im Film handelt, die den eingangs erwähnten Hiob wieder aufnimmt; Hiob den großen Gerechten, der doch die Ungerechtigkeit des Lebens einsehen musste. Vor dem Unglück, so zeigt es Malick, gibt es keinen Schutz, wir sind ihm ohnmächtig ausgeliefert, Leben bedeutet Leiden. Aus der ewigen Perspektive der Kosmologie mögen individuelle Schicksalsschläge nichtig und bedeutungslos sein, unser subjektives Er-Leben aber erschüttern sie, belasten es folgenschwer, zerstören es mitunter. Immer wieder verhandeln die Off-Monologe des Films die Theodizee-Frage explizit: Wie kann so viel Leiden existieren in einer Welt, die von einem gütigen, allmächtigen Gott behütet werden soll? „Warum sollte ich gut sein, wenn du es nicht bist“, fragt der junge Jack (Laienschauspieler Hunter McCracken) jenen Gott, an den er glaubt, dessen Handeln ihm aber unergründlich erscheint. Aus dieser Kleinheit des Menschen gegenüber Natur und Gott entstehen die vielen Untersichten des Films. Wie ein Kleinkind verständnislos und fasziniert auf die Welt seiner mütterlichen Schöpferin blickt, so schaut auch der Mensch auf die Welt seines väterlichen Schöpfers. Gottes Güte wird durch seine Brutalität entzaubert, die Natur erweist sich als indifferent und rücksichtslos destruktiv, und auch die Menschen in „The Tree of Life“ zeichnet eine zugleich gute und böse Doppelnatur aus.
„The Tree of Life“ ist ein tief spirituelles Werk, das sowohl eine naturwissenschaftliche als auch eine religiöse Bewunderung der Welt zulässt. Zwischen „Natur und Gnade“ müsse man sich im Leben entscheiden, heißt es früh im Film. Dann setzen Choräle ein und das Schicksal schlägt zu – das Schicksal, von dem auch eine Predigt im Film handelt, die den eingangs erwähnten Hiob wieder aufnimmt; Hiob den großen Gerechten, der doch die Ungerechtigkeit des Lebens einsehen musste. Vor dem Unglück, so zeigt es Malick, gibt es keinen Schutz, wir sind ihm ohnmächtig ausgeliefert, Leben bedeutet Leiden. Aus der ewigen Perspektive der Kosmologie mögen individuelle Schicksalsschläge nichtig und bedeutungslos sein, unser subjektives Er-Leben aber erschüttern sie, belasten es folgenschwer, zerstören es mitunter. Immer wieder verhandeln die Off-Monologe des Films die Theodizee-Frage explizit: Wie kann so viel Leiden existieren in einer Welt, die von einem gütigen, allmächtigen Gott behütet werden soll? „Warum sollte ich gut sein, wenn du es nicht bist“, fragt der junge Jack (Laienschauspieler Hunter McCracken) jenen Gott, an den er glaubt, dessen Handeln ihm aber unergründlich erscheint. Aus dieser Kleinheit des Menschen gegenüber Natur und Gott entstehen die vielen Untersichten des Films. Wie ein Kleinkind verständnislos und fasziniert auf die Welt seiner mütterlichen Schöpferin blickt, so schaut auch der Mensch auf die Welt seines väterlichen Schöpfers. Gottes Güte wird durch seine Brutalität entzaubert, die Natur erweist sich als indifferent und rücksichtslos destruktiv, und auch die Menschen in „The Tree of Life“ zeichnet eine zugleich gute und böse Doppelnatur aus.
 Indem Malick den frühen Tod eines Protagonisten gleich zu Beginn verrät, spielt er mit der Erwartungshaltung des Zuschauers, der in seinem Wissensvorsprung beständig auf das Einbrechen der Tragödie wartet. Doch diese Antizipation des Schreckens unterläuft der Film immer wieder, „The Tree of Life“ verweigert sich spektakulären Wendungen. Wenn der junge Jack auf ein offenes Fenster im Dachgeschoss zusteuert, fällt er nicht etwa heraus, sondern macht in dem engen Raum mit spitz aufeinander zulaufenden Wänden lediglich eine fast lynchesk-surreale Begegnung mit einem Riesen. Und wenn Jack in einer geschickt konstruierten Szene plötzlich das Leben seines verhassten Vaters in der Hand hat, widersteht er der mörderischen Versuchung. Stattdessen endet der Film ganz sanft mit einer ausgedehnten Traum- oder Jenseits-Sequenz, in der der erwachsene Jack durch einen in der Wüste stehenden Türrahmen mitten in seine Erinnerungen tritt. Hier fallen plötzlich sämtliche Zeitebenen zusammen: Bei einer wunderbaren Choreografie an Stränden und in Salzwüsten begegnet der etwa 50-jährige Sohn seiner vielleicht 40-jährigen Mutter. Die Menschen seines Lebens schreiten zu elegischer Musik an der Wasserkante entlang, die Überbelichtung der Bilder suggeriert eine paradiesische Nachwelt. Das Sein mag unumgänglich mit Leiden verbunden sein, doch am Ende des titelgebenden Lebensbaumes angekommen, wartet in der Malick’schen Vision die Versöhnung mit dem und die Erlösung vom Sein.
Indem Malick den frühen Tod eines Protagonisten gleich zu Beginn verrät, spielt er mit der Erwartungshaltung des Zuschauers, der in seinem Wissensvorsprung beständig auf das Einbrechen der Tragödie wartet. Doch diese Antizipation des Schreckens unterläuft der Film immer wieder, „The Tree of Life“ verweigert sich spektakulären Wendungen. Wenn der junge Jack auf ein offenes Fenster im Dachgeschoss zusteuert, fällt er nicht etwa heraus, sondern macht in dem engen Raum mit spitz aufeinander zulaufenden Wänden lediglich eine fast lynchesk-surreale Begegnung mit einem Riesen. Und wenn Jack in einer geschickt konstruierten Szene plötzlich das Leben seines verhassten Vaters in der Hand hat, widersteht er der mörderischen Versuchung. Stattdessen endet der Film ganz sanft mit einer ausgedehnten Traum- oder Jenseits-Sequenz, in der der erwachsene Jack durch einen in der Wüste stehenden Türrahmen mitten in seine Erinnerungen tritt. Hier fallen plötzlich sämtliche Zeitebenen zusammen: Bei einer wunderbaren Choreografie an Stränden und in Salzwüsten begegnet der etwa 50-jährige Sohn seiner vielleicht 40-jährigen Mutter. Die Menschen seines Lebens schreiten zu elegischer Musik an der Wasserkante entlang, die Überbelichtung der Bilder suggeriert eine paradiesische Nachwelt. Das Sein mag unumgänglich mit Leiden verbunden sein, doch am Ende des titelgebenden Lebensbaumes angekommen, wartet in der Malick’schen Vision die Versöhnung mit dem und die Erlösung vom Sein.
[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ZlRn8wInGKY‘]
The Tree of Life
(USA 2010)
Regie: Terrence Malick; Drehbuch: Terrence Malick; Kamera: Emmanuel Lubezki; Schnitt: Hank Corwin, Jay Rabinowitz, Daniel Rezende, Billy Weber, Mark Yoshikawa; Musik: Alexandre Desplat;
Darsteller: Brad Pitt, Jessica Chastain, Hunter McCracken, Sean Penn, Laramie Eppler, Tye Sheridan
Länge: 138 Min.
Verleih: Concorde
Kinostart: 16.06.2011

