Innerhalb der letzten zwanzig Jahre trat ein philosophisches Problem zunehmend in den Fokus des Interesses, das, bei aller Pauschalität, die man diesem in der Alltagssprache häufig angedeihen lässt, unter den Schlagworten „Gedächtnis und Erinnerung“ zusammengefasst worden ist. In der Kognitionspsychologie, den Geisteswissenschaften und der Hirnforschung sind in diesem Zeitraum die Problemstellungen an den Themenkomplex so zahlreich geworden, dass es nur mit viel Mühe gelingt, sich einen einigermaßen profunden Überblick über das Forschungsfeld zu verschaffen. Doch trotz der Flut an Neuerscheinungen gibt es bis heute keine einheitliche Theorie des Gedächtnisses.
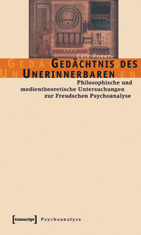 Erik Porath hat sich in seiner umfassenden Dissertation, die Ende 2005 bei [transkript] erschienen ist, ebenfalls dem Thema angenähert. Er gelangt bei seinen Nachforschungen zu der Einsicht, dass der Diskurs die Psychoanalyse Sigmund Freuds bisher merkwürdig unberücksichtigt gelassen habe, obwohl diese sich als geradezu prädestinierte Gedächtnistheorie anböte. Formuliert nicht sogar Freud selber im Abriß seine Programmatik: „Eine irgend beachtenswerte Psychologie muss eine Erklärung des ‚Gedächtnisses’ liefern“? Jedoch bleibt er die konkrete Einlösung der zu Beginn seines Schaffens erhobenen Forderung Zeit seines Lebens schuldig. Freud interessiert das Gedächtnis als den anderen Ort des Subjekts, der dieses in seiner Sinnproduktion dezentralisiert und dem aktiven Zugriff des Bewusstseins über weite Strecken entzieht. Das Gedächtnis ist die Aufzeichnung von Sinn und Unsinn gleichermaßen.
Erik Porath hat sich in seiner umfassenden Dissertation, die Ende 2005 bei [transkript] erschienen ist, ebenfalls dem Thema angenähert. Er gelangt bei seinen Nachforschungen zu der Einsicht, dass der Diskurs die Psychoanalyse Sigmund Freuds bisher merkwürdig unberücksichtigt gelassen habe, obwohl diese sich als geradezu prädestinierte Gedächtnistheorie anböte. Formuliert nicht sogar Freud selber im Abriß seine Programmatik: „Eine irgend beachtenswerte Psychologie muss eine Erklärung des ‚Gedächtnisses’ liefern“? Jedoch bleibt er die konkrete Einlösung der zu Beginn seines Schaffens erhobenen Forderung Zeit seines Lebens schuldig. Freud interessiert das Gedächtnis als den anderen Ort des Subjekts, der dieses in seiner Sinnproduktion dezentralisiert und dem aktiven Zugriff des Bewusstseins über weite Strecken entzieht. Das Gedächtnis ist die Aufzeichnung von Sinn und Unsinn gleichermaßen.
Die Ausgangsfrage, die Poraths Untersuchung leitet, ist also die, warum sich Freud der eigenen Anforderung entzieht und an die Stelle einer ausformulierten Gedächtnistheorie die psychoanalytische Praxis bzw. die Kur treten lässt. Porath stellt seiner Diskursanalyse zwei grundlegende Perspektiven voran, die sich zum einen historisch-kritische auf die diskursiven und außerdiskrusiven Bedingungen der Psychologie des Gedächtnisses um 1900 hinwendet; zum anderen wählt er eine medientechnikorientierte Perspektive, welche die apparativ-technischen Voraussetzungen dieser psychologisch-philosophischen Diskursformation beibringen soll. Letzteres weist er schließlich am Beispiel der empirischen Psychologie Ebbinghausens, Rilkes „Ur-Geräuschen“ oder Schrebers „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“ auf.
Neben den methodischen Fragen, die das Problem des Gedächtnisses bei Freud aufwirft, sowie dem Problem der Wissenschaftlichkeit psychoanalytischer Erkenntnisgewinnung widmet sich die Arbeit vor allem dem operationalen Kernstück der Psychoanalyse – der Assoziation – einen Schwerpunkt. Diese Passagen lesen sich über weite Stecken hinweg wie ein Kommentar zum Begriff der Assoziation und der Assoziationslehre im 19. Jahrhundert. Porath schreitet hier zunächst in einem umfangreichen Überblick die einzelnen geschichtsphilosophischen Stationen ab, die der Begriff bis zu seiner Umarbeitung durch Freud genommen hat. Er macht so zum einen den Einfluss deutlich, den die Philosophie vor der Traumdeutung auf die Lehren ihres Geburtshelfers nimmt und zum anderen wie weit sich Freud schließlich von diesen Vorbedingungen entfernt und die Assoziation in ein eigenständiges Denkmodell überführt.
So skizziert er beispielsweise den Kontrast der Assoziation im englischen Empirismus zum Vorgang der freien Assoziation der Traumarbeit. Ging es bei ersterem noch um die Ähnlichkeitsbeziehungen von Vergangenem und Gegenwärtigen, von Begriff und Ding oder Empfindung und Verstand, so benutzt Freud sie als Konstituenten für den Umwandlungsprozess piktoraler Traumerlebnisse in sprachliche und damit für den Analysanden verwertbare Textkonstruktionen. Dies kann deshalb geschehen, weil sich Freud seinerseits der Ähnlichkeit von Traumzustand und freier Assoziation bewusst ist, die je für sich im Zustand annähernder Zensurfreiheit eintreten. Assoziation wird also zur Erinnerungsarbeit an den latenten Traumgedanken und berührt gleichzeitig das Problem der Darstellung, denn der manifeste Trauminhalt gelangt nur als sprachlicher Text in den Kreislauf der Analyse.
Gerade die Schwierigkeiten der Sprachlichkeit in der Analyse greift Porath eingehender auf, indem er Kittlers Begriff der Medientransposition im Bezug auf den Umwandlungsprozess von Traumbild zur Sprache genauer in den Fokus nimmt. Für Kittler ist die Transposition von einem Medium ins andere die allen weiteren Interpretationen vorgeordnete Operation der Psychoanalyse. „Interpretation wird zum Sonderfall.“ Porath macht dagegen deutlich, dass der Interpretationsbegriff, den Kittler verwendet, auf einen texthermeneutischen Sprachgebrauch zurückgeht, der die editionsphilologischen Vorgriffe der Textkonzeption ausklammert. Da mit der Konstruktion des Textes bestimmte Vorentscheidungen zusammenfallen, die die Textteile als textzugehörig ausweisen, kann hier nicht von einem objektiven Verfahren gesprochen werden. Vielmehr stecken im Versuch einer Bestimmung der Bilder bereits Vorentscheidungen des Verstehensprozesses die sich nicht einfach aus „Material und Anordnung“ ableiten lassen. Es geht also darum, die für die Textkonstruktion konstitutiven Regeln ausfindig zu machen. Dem Begriff der Interpretation wird damit wieder ein gewisses Recht eingeräumt diese Lücke der Transposition zu füllen.
Im Anschluss geht der Autor auf den Begriff des Apparates ein, den er in einer konstruktivistischen Funktionsbestimmung eng mit dem Prozess der Übertragung zusammen denkt. Eine der Ausgangsthesen sieht die Arbeit darin, dass es Freud trotz aller Bemühungen den psychischen Apparat als sich selbst organisierendes System nach ökonomischen, dynamischen und topischen Gesichtspunkten zu ordnen doch nicht gelingt, eine erschöpfende Bestimmung der Bewusstseinsfunktion anzugeben. Für das (dezentrierte) Subjekt, das sich in einem medialen Weltbezug befindet, ist der psychische Apparat der Ort einer Differenzerfahrung. Die Übertragung von Informationen durch Regression, die Porath zwischen Welt und Selbst situiert, wird als Erfahrung der „Unübersichtlichkeit“ begriffen, deren konstruktivistische Bestimmungsversuche immer nur die Näherungswerte technisch-mathematischer Modellbildungen bleibt. Die hierfür diskutierte Metaphorizität des psychischen Apparates zeigt, dass sie angesichts ihrer sprachlichen und medialen Bedeutungs- und Sinnproduktion dem Verstehensprozess bestimmte Vorgriffe abverlangt, die nicht im Horizont der unmittelbaren Erfahrung enthalten sind. Da die Übertragung konstitutiv für das psychoanalytische Verstehen ist, stellt sie immer auch den Bezug auf den Anderen und damit „die Dezentrierung der subjektiven Perspektive“ dar. Die irreduzible Vieldeutigkeit der Übertragung, auf die es Porath hier ankommt, nährt den anderen Ort des nicht immer erinnerbaren Gedächtnisses, der das Subjekt ebenfalls in seinen Handlungen bestimmt.
Nachdem die philosophisch-philologischen Bedingungen der Gedächtnistheorie Freuds geklärt sind, entwirft Portah abschließend eine Gegenüberstellung mit dem deutschen Idealismus am Beispiel Hegels. In dem Maße, in dem das Problem des Anschlusses von Partikularem und Individuellem an die Totalität der begrifflichen Aneignung im Hegelschen System den Begriff des „völlig Vergangenen“, also eines unauflösbaren Restes provoziert, gilt für Freud gerade das Geringfügige als produktiver Faktor der analytischen Deutung. Freud weicht einer Frage nach der Vergänglichkeit nicht aus und begegnet so unweigerlich der allgegenwärtigen Todesproblematik. Anstelle einer Positivität des Gedächtnisses steht die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit und Todestrieb. Vor allem dort, wo er das Augenmerk auf die Frage des Nicht-Vergessens im Angesicht kulturzerstörender Mächte lenkt, beginnt er die Techniken des kulturellen Gedächtnisses als Strategien des Überlebens zu verstehen. Wo Hegel sich noch auf eine Vollendung des Wissens und eine Heilung der „Wunden des Geistes“ beruft, tritt demzufolge Freuds Traumatheorie auf, die eben die unkontrollierte Wiederkehr des Traumatischen und das Nicht-Weichen-Wollen des Traumas umfasst. Die Gedächtnisproblematik der Psychoanalyse zeigt also in diesem geschichtstheoretischen Kontext die Konstellation von Erinnern und Tradieren auf, mit der die Subjekte der Kultur ihr Verhältnis zur Endlichkeit bestimmen.
Porath leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag nicht nur zur Freud-Rezeption, sondern auch zur Gedächtnistheorie insgesamt. Seine luzide Lektüre von Freuds Werk spielt mit dessen verschiedenen Lesarten hermeneutischer, konstruktivistischer, systemtheoretischer und dekonstruktivistischer Herkunft und schafft es so, nicht nur eine der umfassendsten und dichtesten Auseinandersetzungen mit der Materie herauszuarbeiten, er rehabilitiert auch den oftmals naiv gelesenen Freud für die Philosophie. Gerade dort wo seit den letzten Jahren immenser Nachholbedarf besteht, nimmt Porath die Lektüre auf und führt den Leser en detail an die Gelenkstellen und Zwischenräume der Psychologik um die Jahrhundertwende heran. Porath demonstriert hier sehr deutlich sein philosophisches Anliegen: Es geht ihm nicht darum, wie häufig von Seiten der Philosophie befürchtet wird, eine Psychoanalyse der Philosophie sondern, wie beispielsweise von Derrida gefordert, die Philosophie der Psychoanalyse herauszustellen. Damit gelingt ihm, was viele seiner Vorgänger nicht zu Wege brachten und er macht dieses Werk zu einer der wichtigsten Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum.
Erik Porath
Gedächtnis des Unerinnerbaren
Philosophische und medientheoretische Untersuchungen zur Freudschen Psychoanalyse
Bielefeld: Transcript 2005
540 Seiten (broschiert)
34,80 Euro

