Abschied
von Gestern
Über
den Jungen und den Neuen Deutschen Film von 1962 bis in die Gegenwart?
1. Das
Brot der frühen Jahre
Verdächtig
war schon immer der Künstler, der etwas mitzuteilen hatte, das sich im Jenseitigen
der ökonomischen Einheitsaussagen ansiedelte. Parteigängertum warf man ihm schlimmstenfalls
vor; und wenn diese Aussage dann auch noch ganz unverhohlen soziale oder politische
Implikationen trug, so konnte sich der Künstler einer regen und zum Ärger erregten
Öffentlichkeit bereits sicher sein. Dies gilt heute genauso wie 1945 in der
 Bundesrepublik.
Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren
der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,
das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven
soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen
wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.
Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter
wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.
1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest
(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms
endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland
anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den
50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern
mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht
weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.
In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten
Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des
nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die
jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum
einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,
an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde
- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu
stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation
mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend
die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden
und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand
als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die
dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,
die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki
mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler
um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene
Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)
standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys
Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer
Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren
Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.
Bundesrepublik.
Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren
der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,
das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven
soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen
wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.
Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter
wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.
1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest
(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms
endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland
anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den
50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern
mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht
weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.
In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten
Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des
nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die
jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum
einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,
an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde
- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu
stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation
mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend
die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden
und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand
als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die
dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,
die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki
mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler
um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene
Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)
standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys
Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer
Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren
Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.
2. Auch
Zwerge haben klein angefangen
Der Ablösungsprozess
des jungen deutschen Films von der Nachkriegsfilmhistorie verlief radikal und
nicht selten in Form bitterer, parodistischer Anfeindungen. Eine neue Riege
Regisseure, von denen nur noch Alexander Kluge und Edgar Reitz zur Gründergeneration
gehörten, machte sich in deutschen und bald auch internationalen Kinos einen
Namen: Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Jean-Marie
Straub, Wim Wenders und Margarethe von Trotta zählten zu den Nachwuchsregisseuren,
die alsbald kanonisiert wurden. Mit den Studentenrevolten Ende der 60er und
Anfang der 70er Jahre, erhielten diese Autoren neuen Zuspruch: Ein nun intellektuell
und politisch emanzipiertes junges Filmpublikum hatte eine Kunst gefunden, mit
der es sich nicht nur identifizieren konnte, sondern die gleichsam mit zur politischen
Bewusstwerdung verhalf. Gerade die bissigen Attacken Fassbinders auf die Biederkeit
der Deutschen (Katzelmacher und Warum läuft Herr R. Amok? beide von 1969), Schlöndorffs
Parabeln auf die NS-Ideologie in den Köpfen (sein Debut Törless von 1965 und
später seine Kleist-Adaption von Michael Kolhaas von 1969) waren ein gefundenes
Fressen für diese Jugend einer heißen Gesellschaft, die sich gegen die überkommenen
Werte ihrer Eltern und Großeltern auflehnen wollte. Auch die äußerst fruchtbare
Kooperation zwischen Wim Wenders und dem genialischen Schriftsteller Peter Handke,
die 1970 zu dem Film Angst des Tormanns beim Elfmeter führte, reihte sich in
die Liste der engagierten Werke ein: Der Film stellt ein Manifest über das Entfremden
des Menschen von der eigenen Sprache dar, die zwar benutzt aber nie mehr verstanden
werden kann. Auf eigentümliche Weise schert Werner Herzog aus dem doch recht
offensichtlichen politischen Duktus des Neuen Deutschen Films aus. Bereits seine
allerfrühesten Beiträge 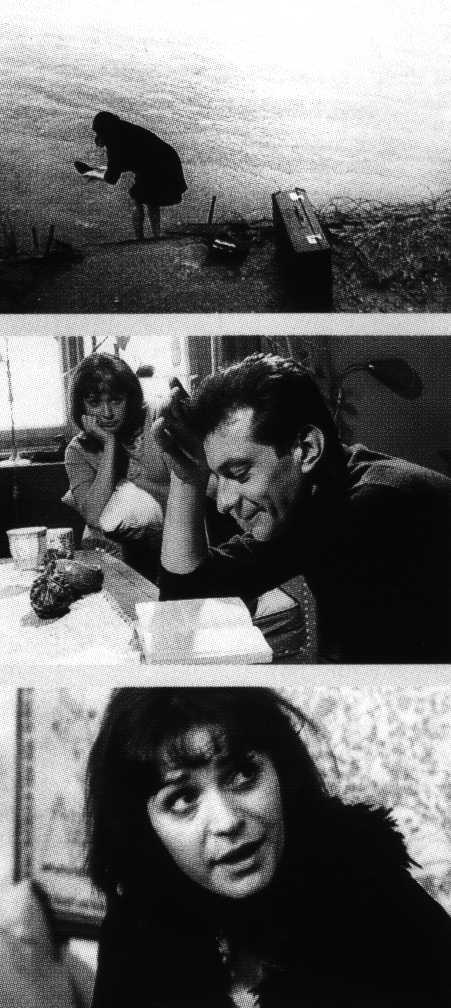 (Lebenszeichen
von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher
zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter
zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit
dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen
Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik
der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch
allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald
ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten
in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn
Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten
fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem
Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen
Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten
Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")
Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm
daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt
den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen
mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller
überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen
und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick
aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des
Geschehens macht.
(Lebenszeichen
von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher
zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter
zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit
dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen
Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik
der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch
allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald
ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten
in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn
Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten
fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem
Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen
Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten
Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")
Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm
daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt
den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen
mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller
überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen
und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick
aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des
Geschehens macht.
3. Die
dritte Generation
Es ist viel
geschrieben worden über diese Phase des Neuen Deutschen Films von 1968 bis 1982
- dem Jahr in dem Rainer Werner Fassbinder starb. Das Phänomen des Autorenfilms
wurde eingereiht in die Strömungen des europäischen Films nach dem Zweiten Weltkrieg
(Neo Verismo in Italien, Nouvelle Vague in Frankreich oder New Cinema in Großbritannien).
Damit war der Neue Deutsche Film ein echter Spätzünder: Als 1968 gerade die
ersten Werke ins Kino gekommen waren, gab es die Nouvelle Vague schon nicht
mehr. In Frankreich hatten sich die Autorenfilmer untereinander zerstritten
und deren Filme sich zum Ende nicht mehr an den Kinokassen amortisiert. Dieses
Schicksal teilte der Neuen Deutsche Film mit ihnen allerdings von Anbeginn:
"Soviel Aufsehen der »Neue Deutsche Film« der siebziger Jahre mit seinen Regie-Stars
Fassbinder, Herzog, Wenders, von Trotta und Schlöndorff auch erregt, von wenigen
Ausnahmen wie »Die verlorene Ehre der Katarina Blum« [von Schlöndorff] abgesehen,
beschränkt sich der nationale wie internationale Erfolg auf die Kritik und ein
intellektuelles Publikum. Kaum ein Werk kann seine Herstellungskosten an der
Kinokasse amortisieren, die meisten sind einzig durch die Hälfte des frisch
installierten Subventionssystems lebensfähig.", konstatiert Gundolf Freyermuth.
Die Ökonomie war es dann auch - neben dem Verlust des intellektuellen Anführers
Fassbinder, der sich schlicht zu Tode gearbeitet hatte! -, die dem Neuen Deutschen
Film das Genick gebrochen hat. In einer Zeit, wo finanzieller und künstlerischer
Erfolg gern miteinander verwechselt wurden, war bald kaum jemand mehr bereit,
in diese zwar genuin deutsche, doch leider auch erfolglose Kunst zu investieren.
Immer häufiger gingen die Regisseure auf ausländische Produktionsreisen, um
dort ihre Projekte zu inszenieren und zu finanzieren. Schlöndorff wird 1980
durch den Oscar für seine Blechtrommel-Adaption nach Amerika gelockt, wo es
ihm zusehends besser gefällt. Herzog verlegt sein Domizil Ende der 80er Jahre
in die USA und von damaligen Regisseuren wie Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich
weiß man heute schon gar nicht mehr, dass sie keine Amerikaner sind. Diese Reisewelle
mündete schließlich ein einen echten Regisseur-Exodus, wie man ihn seit der
NS-Zeit nicht mehr erlebt hatte. Heute erreichen uns ab und zu Schlöndorffs
Werke (Palmetto von 1998) oder Wim Wenders Filme (Buena Vista Social Club von
1999) aus der Diaspora. Diejenigen, die hiergeblieben sind, wie etwa Alexander
Kluge, versuchen ihr Geld anderweitig zu verdienen: Kluge tritt als Produzent
und Kopf des "dctp" auf, einer Gesellschaft, die z. B. die "lange Wa(h)re Liebe
Nacht" ins Vox-TV bringt. Heute regieren neue "junge Wilde" das deutsche Kino.
Namen wie Sönke Wortmann oder Tom Tykwer sind nun auch international in aller
Munde. Ihre Filme bringen das Geld, das die deutschen Studios bis dahin von
den amerikanischen unterschieden hatte. Doch die Pseudoemanzipiertheit einer
Katja von Garnier oder die hirnlos-witzlosen Klamotten von Wortmann können sich
in kaum eine Tradition stellen; wenn doch, dann am ehesten in die des Heimatfilmes.
Der neueste deutsche Film verlegt sein kritisches Potential auf pubertäre Fragen
wie "Wieviel Männer braucht eine Frau, um befriedigt zu werden?" oder "Sind
Schwule nicht witzige Typen?". Die Erörterung der (mörderisch) langweiligen
Frage, "wer mit wem schlief", bildet einhellig wie einfältig das Zentrum beinahe
eines jeden neuesten deutschen Films. Diese dritte Generation deutscher Nachkriegsregisseure
- denen sich auch Autoren der älteren Riege, wie Margarethe von Trotta oder
Doris Dörrie manchmal zugesellen - lehnt soziale oder politische Stellungnahmen
in ihren Filmen rigoros ab. Weil sie so unkritisch sind, sind sie so erfolgreich.
Damit haben auch sie ihr Publikum gefunden, das den schon einmal dagewesenen
Paradigmenwechsel des Kinos genauso ignoriert; und auch ihr Motto heißt: "Der
alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen."
[Stefan Höltgen]
Das
Oberhausener Manifest
 Der
Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten
Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film
die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren
und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen
auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.
Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films
bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.
Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld
des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen
Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von
den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle
Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.
Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale
und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche
Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.
Der
Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten
Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film
die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren
und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen
auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.
Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films
bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.
Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld
des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen
Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von
den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle
Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.
Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale
und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche
Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.
Oberhausen,
28.2.1962
(Unterzeichner:
Bodo Blüthner, Boris von Borresholm, Chrisitan Doermer, Bernhard Dörries, Heinz
Furchner, Rob Houwer, Ferdinand Khittl, Alexander Kluge, Pitt Koch, Walter Krüttner,
Dieter Lemmel, Hans Loeper, Ronald Martini, Hansjürgen Pohland, Raimund Ruehl,
Edgar Reitz, Peter Schamoni, Detten Schleiermacher, Fritz Schwennicke, Haro
Senft, Franz-Josef Spieker, Hans Rolf Strobel, Heinz Tichawsky, Wolfgang Urchs,
Herbert Vasely, Wolf Wirtz)
 Bundesrepublik.
Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren
der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,
das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven
soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen
wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.
Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter
wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.
1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest
(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms
endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland
anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den
50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern
mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht
weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.
In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten
Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des
nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die
jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum
einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,
an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde
- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu
stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation
mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend
die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden
und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand
als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die
dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,
die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki
mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler
um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene
Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)
standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys
Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer
Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren
Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.
Bundesrepublik.
Sicherlich: Damals kam die Kritik an den Umständen und das beständige Herbeizitieren
der jüngsten Vergangenheit nicht gut an, weil man doch "neu anfangen" wollte,
das Schlimme hinter sich und das Gute vor sich sehen wollte. Heutzutage nerven
soziale oder politische Aussagen der Kunst nur noch, weil sie uns dazu bewegen
wollen, doch endlich etwas zu unternehmen gegen die angeprangerten Missstände.
Aus dieser Sicht muss der damals Junge bzw. Neue Deutsche Film heute antiquierter
wirken, als die Filmbeiträge, die dieses Projekt damals hinter sich lassen wollte.
1961 unterschrieben 26 junge deutsche Filmregisseure das Oberhausener Manifest
(siehe Kasten), um das Grab des von ihnen so sehr verabscheuten Heimatfilms
endgültig zu betonieren und zu versiegeln, damit nun eine neue Filmära in Deutschland
anbräche. Das Gespenst der Geschichtslosigkeit, das der Heimatfilm seit den
50er Jahren in der bundesdeutschen Filmlandschaft verbreitete, schien den Unterzeichnern
mehr als reaktionär. In den Melodramen und Bergfilmschinken erblickten sie nicht
weniger als die Leugnung der Greuel des zweiten Weltkrieges und des NS-Regimes.
In seiner aseptischen Sexualfeindlichkeit, der allenfalls rudimentär abgebildeten
Klassenunterschiede und dem Insistieren auf dem Heimat-Begriff (der dem des
nazistischen Blut-und-Boden-Begriffs unendlich nah zu stehen schien) sahen die
jungen Regisseure Substanz genug, um sich künstlerisch daran abzuarbeiten. Kaum
einer der Filme vor 1962 - genauer gesagt: vor dem 28. Februar diesen Jahres,
an dem auf dem Kurzfilmfest in Oberhausen das Manifest veröffentlicht wurde
- konnte den Ansprüchen gerecht werden, die die Wirklichkeit an die Kunst zu
stellen schien: die Fragen vom Verhältnis des Menschen zur Arbeit, die Konfrontation
mit dem Schrecken des Krieges, die politischen Querelen oder schlicht und ergreifend
die soziale Isolation. Das alles war bis dahin vom Film verschwiegen worden
und sollte nun umso eindringlicher auf's Tapet. "Der »Junge Deutsche Film« entstand
als eine simple Bündelung von Leuten, von einem halben Dutzend Verrückter, die
dem Schnulzenkartell Paroli boten." (Volker Schlöndorff) Die wenigen Autoren,
die bis dahin bereits versucht hatten, kritisch zu filmen (z. B. Bernhard Wicki
mit seinem Film Die Brücke von 1959), konnten in den Bestrebungen der Künstler
um Alexander Kluge nur ihre Bestätigung finden. Im gleichen Jahr erschienene
Filme, wie Freddy und das Lied der Südsee (von Gerhard Krüger mit Freddy Quinn)
standen nun auf einmal sozialpolitisch anspruchsvollen Werken, wie Herbert Veselys
Böll-Adaption Das Brot der frühen Jahre gegenüber. Ein früher Beitrag in einer
Reihe von Filmen, die fast so etwas wie eine eigene Tradition einläuteten, deren
Ausläufer ein viertel Jahrhundert deutsche Filmgeschichte prägten.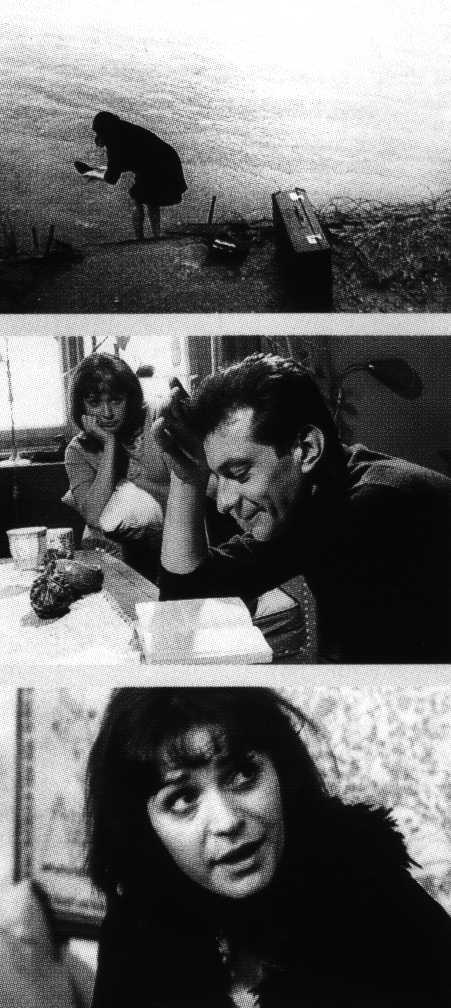 (Lebenszeichen
von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher
zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter
zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit
dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen
Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik
der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch
allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald
ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten
in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn
Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten
fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem
Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen
Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten
Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")
Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm
daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt
den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen
mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller
überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen
und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick
aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des
Geschehens macht.
(Lebenszeichen
von 1962 oder Auch Zwerge haben klein angefangen von 1968) ließen sich eher
zum surrealistischen Film rechnen, als den engagierten Werken seiner Mitstreiter
zur Seite stellen. Herzog operiert von Anfang an stärker mit dem Bild als mit
dem Plot. Und dennoch zählen er und andere seine Arbeit zum Gros des Neuen Deutschen
Films: "Wir waren Chronisten, wir haben das eingefangen, was die innere Chronik
der Epoche ausmacht.", sagt Herzog rückblickend. Für ihn ist diese Chronik jedoch
allenfalls metaphorisch Gegenstand seiner Filme geworden, die sich schon bald
ganz und gar von der bundesdeutschen Realität abwandten und ihre Protagonisten
in vergangene Zeiten und ferne Urwälder verschlugen (etwa Aguirre - Der Zorn
Gottes von 1972 oder Fitzcarraldo von 1981). Die Realität am schonungslosesten
fing damals wohl Alexander Kluge ein. Und das in einem zweifachen Sinn: In seinem
Spielfilm-Debut Abschied von Gestern konfrontierte er nicht nur seine jüdischen
Protagonistin, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, mit der harten
Realität des Kapitalismus. Er kehrt sich auch bewusst von ("branchenüblichen")
Darstellungstraditionen des Films ab und lässt seinen Spielfilm wie einen Dokumentarfilm
daherkommen - ganz wie es der realitätsnahe Stoff verlangt: Die Kamera taumelt
den Ereignissen oft vollständig entfesselt hinterher, der Ton hält zusammen
mit dem Bild Distanz, so dass oft nur schwer zu verstehen ist, was die Darsteller
überhaupt sagen. Der "Abschied von Gestern" wird hier auf mehreren Ebenen vollzogen
und entwirft (lange vor Dogma 95!) eine Filmtechnik, die den Betrachterblick
aus seiner "Voyeur"-Position (Laura Mulvey) herauszieht und zum Mittäter des
Geschehens macht.  Der
Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten
Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film
die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren
und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen
auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.
Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films
bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.
Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld
des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen
Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von
den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle
Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.
Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale
und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche
Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.
Der
Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten
Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film
die Chance, lebendig zu werden. Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren
und Produzenten erhielten in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen
auf internationalen Festivals und fanden Anerkennung der internationalen Kritik.
Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films
bei denen liegt, die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen.
Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und Experimentierfeld
des Spielfilms geworden. Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen
Spielfilm zu schaffen. Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von
den branchenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle
Partner. Freiheit von der Bevormundung durch kommerzielle Interessengruppen.
Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale
und wirtschaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche
Risiken zu tragen. Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.